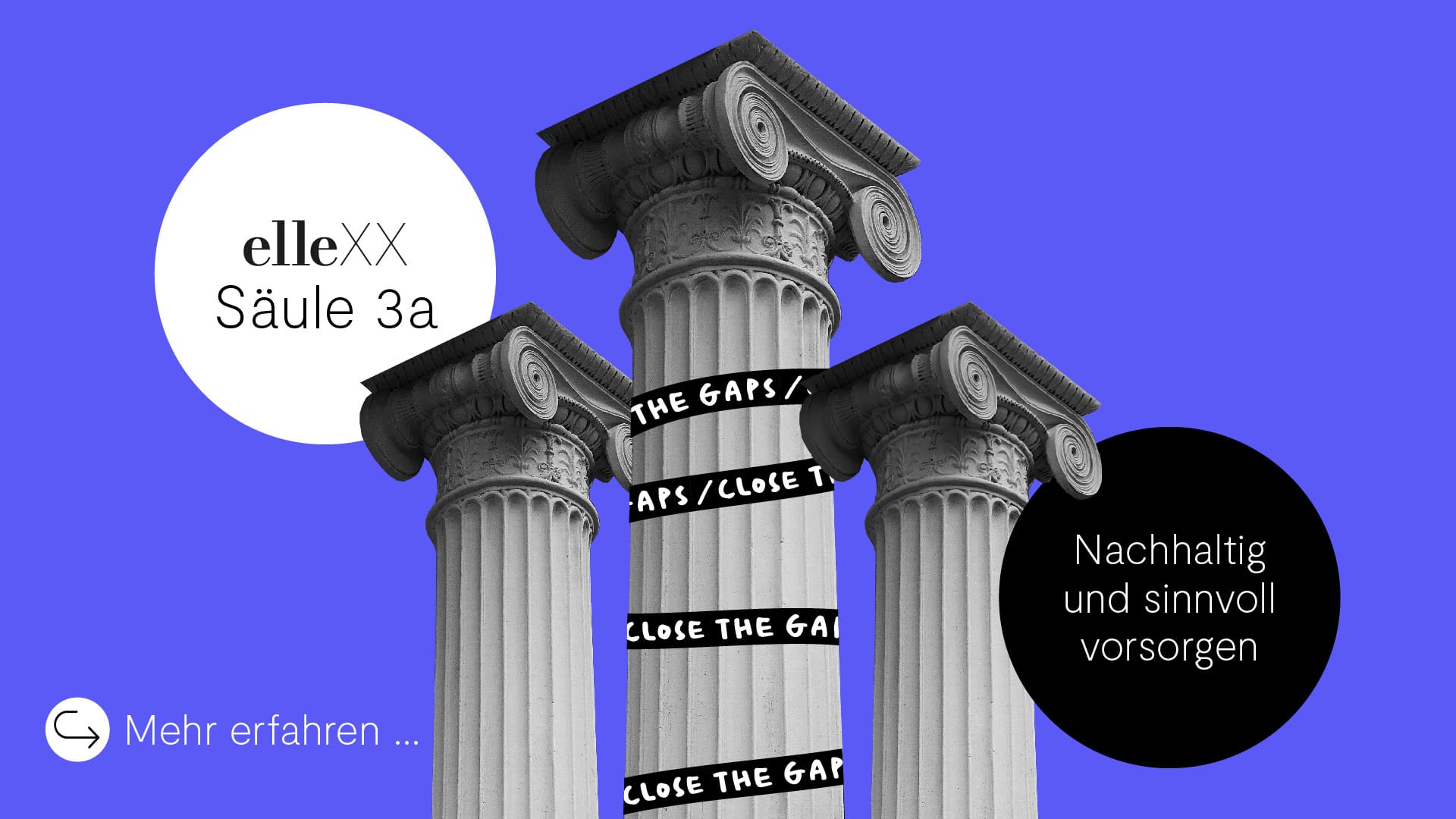In meinem Elternhaus war (und ist!) Weihnachten keine grosse Sache: Einen Baum haben wir schon etliche Jahre nicht mehr, das letzte Geschenk habe ich bekommen, als ich 16 Jahre alt war. Am 24. Dezember essen meine Mutter und ich zusammen, meistens Gschwellti mit Chäs und Salat, und zünden ein paar Kerzen an. Das wars dann auch schon.
Weihnachten nicht zu feiern, hat viele Vorteile: Während meine Freund:innen durch die Stadt hetzen, nutzlose Weihnachtsgeschenke kaufen und im Getümmel beinahe ein Herzchriesi erleiden, sitze ich entspannt zu Hause im Warmen und brauche mich um nichts zu kümmern. Ich weiss schon gar nicht mehr, wie sich ein erwartungsinduzierter Familienkonflikt zum Jahresende hin anfühlt, und wenn andere über Feiertagspfunde jammern, komme ich gestählt aus dem Gym. Ich bin mit der Situation also nicht ganz unglücklich.
Das war allerdings nicht immer so. Früher sehnte ich mich nach diesem Gefühl von Zusammengehörigkeit, das Weihnachten anhaftet. Ich wollte auch im trauten Kreis einer grossen Familie Weihnachtslieder singen, viele Geschenke bekommen und kiloweise Weihnachtsguetsli essen. Ich erinnere mich, wie ich als Kind durch das winterliche Zürich lief, nach bunten Lichtern in fremden Fenstern schielte und mir vorstellte, wie glücklich die Menschen hinter den Fenstern in den Wohnungen wohl sein mochten.
Das klingt jetzt so, als wäre meine Kindheit ganz schrecklich gewesen. Das ist überhaupt nicht so. Dass Weihnachten bei uns eher spartanisch gefeiert wird und wurde, hat andere Gründe.
Erstens: Meine Familie ist sehr klein. Sie besteht aus mir, meiner Mutter und meinem Bruder. Warum das so ist, ist ein Thema für ein anderes Mal.
Zweitens: Wir hatten nicht besonders viel Geld. Teure Geschenke lagen ebenso wenig im Budget meiner alleinerziehenden Mutter wie tagelange Vorbereitungen in der Küche.
Drittens: Meine Mama ist eine noch viel grössere Feministin als ich. Und dazu hat sie auch allen Grund: 1949 in der Innerschweiz geboren, wurde sie volljährig, als Schweizer Frauen noch das Stimmrecht verweigert wurde. Kein Wunder, war und ist sie wütend – und kein Wunder, lehnt sie die patriarchale Grundordnung der Welt vehement ab.
Die Religion nun ist ein elementarer Teil dieser patriarchalen Grundordnung. Im Namen Jesus Christus' wurden Frauen jahrhundertelang unterdrückt, versklavt und getötet. Schätzungsweise 80’000 von ihnen wurden als «Hexen» auf den Scheiterhaufen des christlichen Fundamentalismus verbrannt. Feministinnen wie meine Mutter sind dem Mann aus Nazareth folgerichtig nicht besonders wohlgesinnt – auch wenn ihnen natürlich klar ist, dass er selber herzlich wenig Schuld an den Sünden trägt, die in seinem Namen später begangen wurden.
Viertens: Ich bin nicht nur in einem sehr feministischen Haushalt aufgewachsen, sondern auch in einem äusserst kapitalismuskritischen. Fragt man meine Mutter, so gehen diese beiden Haltungen ohnehin Hand in Hand: Feminismus hinterfragt ein Wirtschaftssystem, das von weissen Männern für weisse Männer konstruiert wurde und auf der Gratisarbeit von Frauen fusst. Meiner Mutter war also nicht nur die Huldigung eines seit 2000 Jahren toten Mannes zuwider – so menschenliebend dieser als Mensch auch gewesen sein mag –, sondern auch die damit einhergehende Konsumorgie.
Als Kind habe ich diese Haltung nur teilweise verstanden – wenn überhaupt. Kürzlich besuchte ich jedoch, auf der Suche nach einem Geschenk für meine Patentochter, ein Spielwarengeschäft in der Zürcher Innenstadt. Und was ich sah, beelendete mich nachhaltig: Krähende Kinderhorden, entnervte Eltern, übernächtigtes Verkaufspersonal an der Grenze zum Nervenzusammenbruch. Und eine haarscharfe, rosa-blaue Trennlinie, die mitten durch den Laden lief, und sowohl Spielsachen als auch Kinder in zwei Gruppen trennte. «Die Mädchen zum Puppenhaus, die Jungs zum Lego, aber dalli! Damit wir bloss in Zukunft keine Hausmänner haben in diesem Land – und bitte auch keine Ingenieurinnen!» Das war ganz eindeutig die Message.
Das Wort Gender-Apartheid drängte sich mir auf, und ich kämpfte mit dem Reflex, den Laden wutschäumend sofort wieder zu verlassen.
Das tat ich natürlich nicht. Ich dachte an dieses kleine Mädchen, das ich vor 30 Jahren war. Wie es durch die bunt beleuchteten Fenster anderer Leute schielte und sich eine heile Welt vorstellte. Wie ich von Guetsli und Glück fantasierte und die anderen Kinder beneidete.
Ich kaufte ein Geschenk: Genderneutral, aus Holz, und in der Hoffnung auf eine bessere Welt.
Merry Christmas, everyone!