Die Credit Suisse ist Geschichte. Nach 167 Jahren wurde sie vom Staat mit ihrer grössten Rivalin zwangsverheiratet, oder von dieser geschluckt. Wie auch immer: die Credit Suisse existiert nicht mehr, und das löst Schockwellen in der ganzen Schweiz aus.
Wie konnte es aber überhaupt so weit kommen?
Das Debakel der Credit Suisse hätte grundsätzlich über drei Mechanismen verhindert werden können: durch Regulierung, die eingreift, sobald Grenzen überschritten werden; durch ökonomische Anreize, die dafür sorgen, dass sich unmoralisches Verhalten nicht lohnt – also durch den sogenannten Markt, – oder durch die innere Werthaltung respektive das Ethos von Entscheidungsträger:innen.
Im Fall Credit Suisse hat keiner dieser drei Mechanismen funktioniert.
Die Regulierung hat nicht oder zu spät gegriffen. Dieser Umstand sorgt zu Recht für heftige Diskussionen unter Politiker:innen und Jurist:innen. Warum haben wir nach der Finanzkrise und dem 60-Milliarden-Bailout der UBS scheinbar klare, verbindliche Regeln für «too big to fail»-Banken erlassen, wenn diese im entscheidenden Moment durch Notrecht über den Haufen geworfen werden können? Warum haben wir keine Gesetze, die dafür sorgen, dass Entscheidungsträger:innen früher – oder überhaupt – zur Rechenschaft gezogen werden für Rechtsverletzungen, die unter ihrer Führung passieren?
Regelverstösse waren offenbar die Regel
Die Regulierung hat also versagt. Wie sieht es mit dem Markt und den ökonomischen Anreizen aus? Es gibt Leute, die behaupten, in einem «gesunden» Markt würden monetäre Anreize dafür sorgen, dass sich schlechtes Verhalten nicht lohnt. Im Fall Credit Suisse war aber auch dieses reine Wunschdenken, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen.
Die Credit Suisse kassierte in den letzten zehn Jahren Bussen von insgesamt mehreren Milliarden Franken. Erhalten hatte die Grossbank sie aufgrund ganz unterschiedlicher Vergehen: von der Verwicklung in die Staatspleite von Mozambique über das unsachgemässe Löschen von Whatsapp-Chats mit US-Kund:innen bis zur Irreführung von Anleger:innen im Hypothekargeschäft. Und last but not least: Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Das Bussenportfolio spricht eine deutliche Sprache: Regelverstösse waren bei der Credit Suisse offensichtlich endemisch und gehörten fast schon dazu. Offenbar schmerzten die hohen Bussen, Vergleichs- und Schadenersatzzahlungen die Bank auch zu wenig, um deren Verhalten zu ändern. Sie konnte sich diese Ausgaben leisten. Oder meinte es zumindest.
Vielleicht war das Management der Credit Suisse insgeheim gar der Meinung, der Nutzen, der durch die Missachtung der Regeln entstand, sei grösser als der finanzielle Schaden durch die Rechtsstreitigkeiten.
Hohe Bussgelder – und hohe Boni
Und das bringt uns zum dritten Mechanismus, der versagt hat: der Werthaltung. Innere Überzeugungen. Charakter. Ethos. Niemand anerkannte, dass jeder einzelne Fall ein Beweis für ein Fehlverhalten war, mit dem andere geschädigt wurden, und dass aus ethischer Perspektive solche Schäden a priori und um jeden Preis vermieden werden müssten. Eine derartige Einsicht hätte die Credit Suisse dazu gezwungen, nicht nur ihr Verhalten im Einzelfall, sondern das ganze Geschäftsmodell oder zumindest ihre Hochrisikostrategie zu überdenken. Aber das wollte wohl niemand. Lieber gönnten sich die Führungsgremien hohe Boni, während die Bank gleichzeitig hohe Bussgelder zu bezahlen hatte. Die Führung erweckte damit den Eindruck, sie wollten sich für ihre Schlaumeierei auch noch belohnen.
Die Ereignisse der letzten Jahre werfen kein gutes Licht auf die Werthaltungen der Entscheidungsträger:innen der Credit Suisse. Wer kassiert schon guten Gewissens millionenhohe Entschädigungen in Zeiten, in denen ein Unternehmen hohe Bussen wegen wiederholten Fehlverhaltens bezahlen muss? Das zu tun, zeugt von einem äusserst seltsamen Verständnis von Verdienst. Und zwar Verdienst nicht im finanziellen, sondern im moralischen Sinn. Honorar bedeutet wörtlich «Anerkennung für geleistete Dienste». Die Frage, die sich bei der Credit Suisse offensichtlich niemand gestellt hat, lautet: Habe ich diese Anerkennung wirklich verdient?
Fügt man dem Ganzen noch ein paar Anekdoten hinzu, wird das Bild noch düsterer. Denken wir an die Abgehobenheit des Verwaltungsratspräsidenten Horta Osorio, die ihn Anfang 2022 seinen Sitz kostete. Während der Pandemie wurden Millionen von Menschen aufgrund strenger Quarantäneregeln vom Reisen abgehalten. Währenddessen nahm sich Osorio das Recht heraus, im Privatjet zwischen europäischen Metropolen hin und her zu pendeln, ohne die behördlich verordnete Zwangspause einzulegen. Oder erinnern wir uns an das seltsame Gebaren von Tidjane Thiam, dem ehemaligen CEO der Credit Suisse, der mehrere hochrangige Mitarbeiter heimlich überwachen liess. Und das sind nur zwei von vielen Beispielen, bei denen die Alarmglocken schrillten, die aber offensichtlich keine fundamentalen Änderungen auslösten.
Schadenfreude trifft die Falschen
Nichts und niemand hat das Debakel also verhindert. Weder Regulierung, noch der Markt, noch Führungspersonen mit Integrität. Kein Wunder, ist das Vertrauen gleich mehrfach und nachhaltig erschüttert. Und kein Wunder, reagiert die Öffentlichkeit mit Wut. Das ist nachvollziehbar.
Nicht nachvollziehen kann ich aber die Schadenfreude, mit der dem Ende der «Abzockerbank» vereinzelt begegnet wird. Diese Reaktion ist kalt und kurzsichtig. Nicht nur bangen tausende Angestellte der Credit Suisse und der UBS um ihren Job. Auch unzähligen Dienstleister:innen, die für die Credit Suisse Aufträge erledigten, drohen empfindliche Einbussen. Von Grafikbüros über Reinigungsunternehmen hin zum Restaurant, der Physio-Praxis oder dem Coiffeursalon direkt neben einem grossen Credit-Suisse-Standort: Alle sind betroffen. Ebenso wie der Sport, der Kulturbereich und viele gemeinnützige Organisationen, die von der Credit Suisse grosszügig unterstützt wurden.
Deshalb: Wut, ja. Schadenfreude als Ausdruck von Kälte und Kurzsichtigkeit: nein. Schon alleine deshalb, um uns in aller Form von allem zu distanzieren, was auch nur im Entferntesten an das Verhalten der Verantwortlichen erinnert.
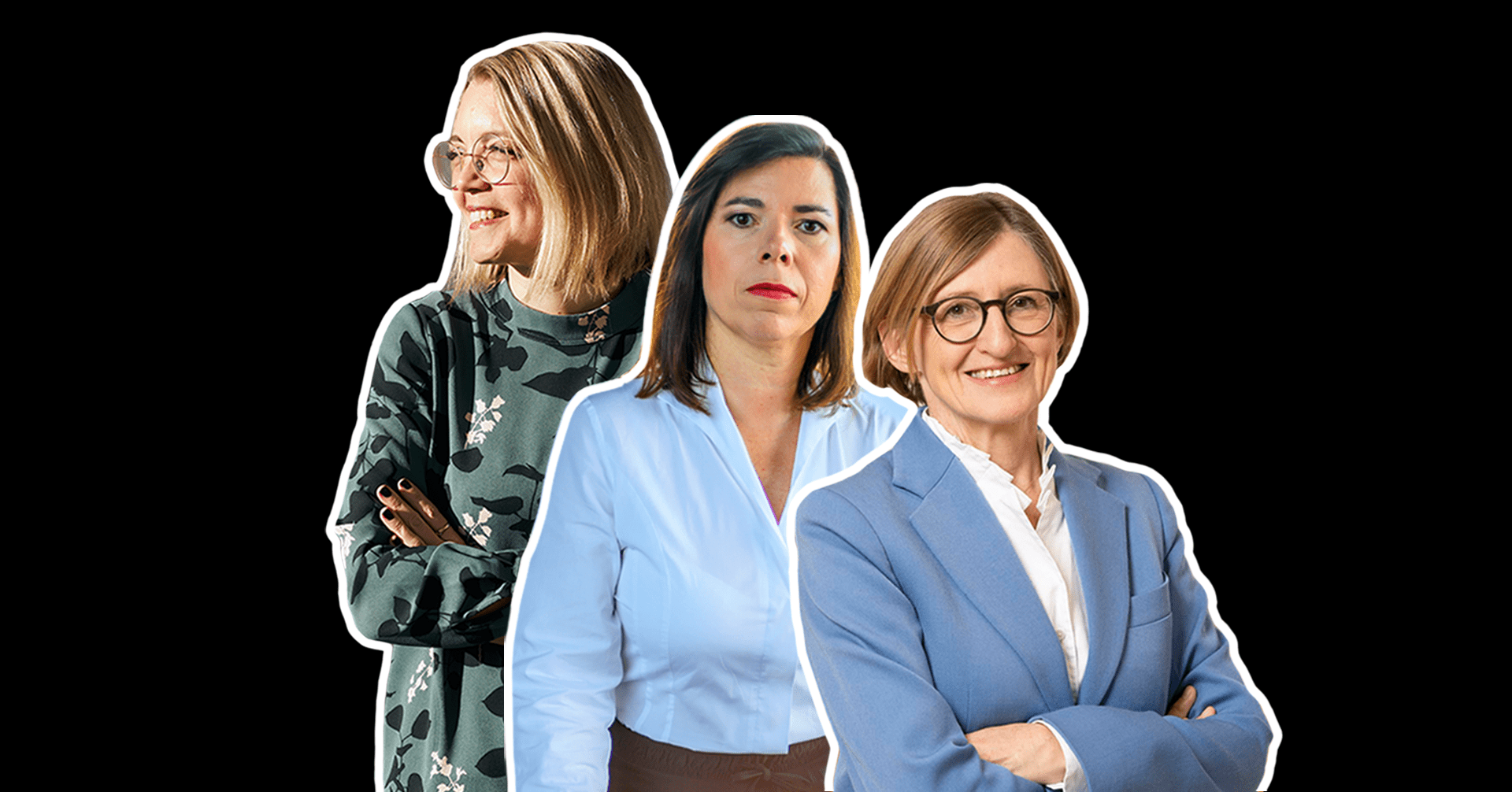



.jpg-.jpg)




