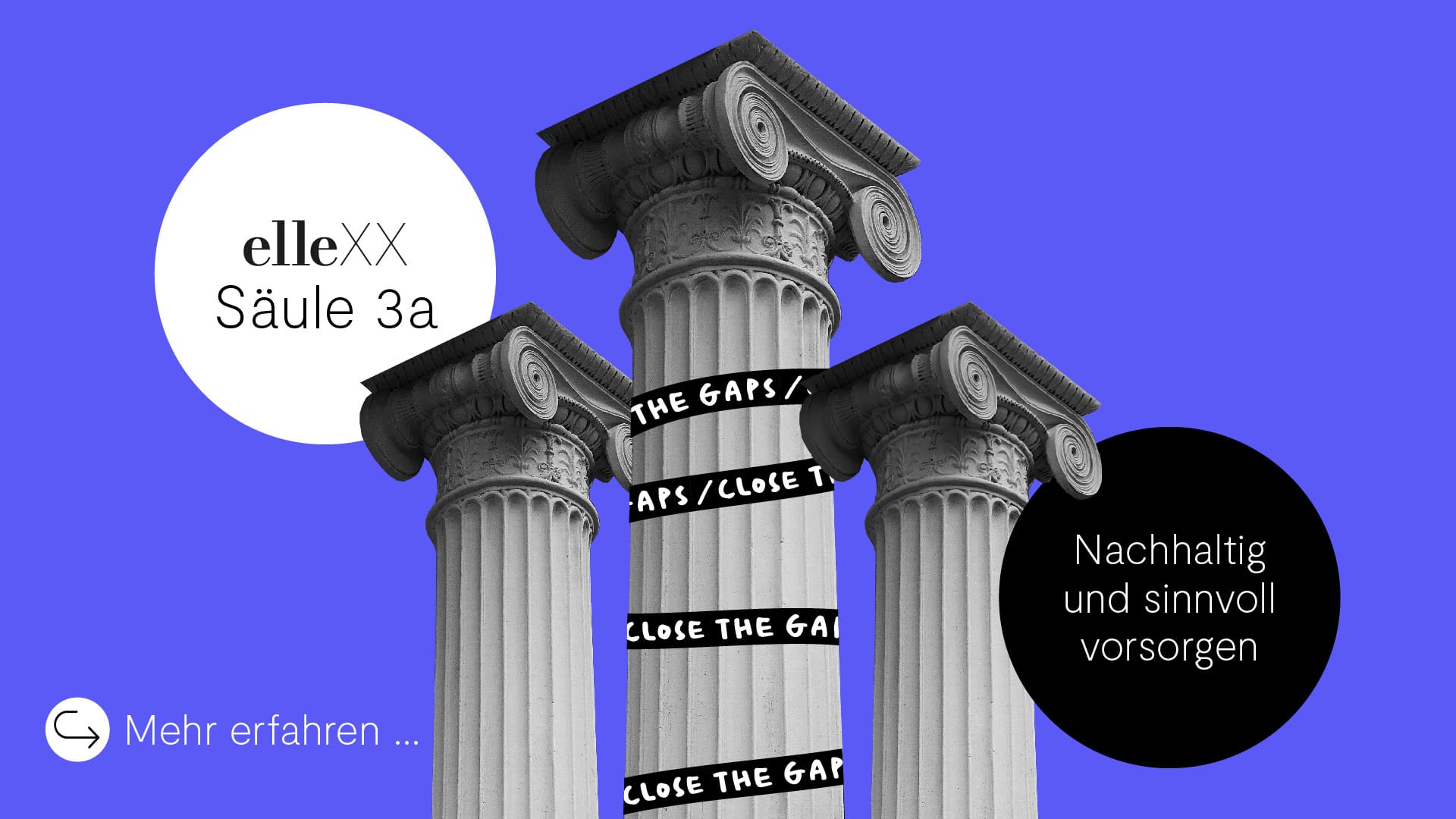Die Credit Suisse ist Geschichte. Wie konnte es mit der Schweizer Traditionsbank so weit kommen? Welche Strukturen liegen einem System zugrunde, das solche Ergebnisse hervorbringt und ein solches Versagen nicht verhindert? Welche toxischen Kulturen befeuern dieses System? Wir haben drei Ökonominnen dazu befragt. Das grosse Interview:
Monika Bütler ist Ökonomin und Honorarprofessorin für Volkswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen (HSG). Sie hat auch an der Universität Zürich, der Universität Bern und der Australian National University gelehrt. Ihre Forschung konzentriert sich auf öffentliche Finanzen, Arbeitsmarktökonomie und Rentensysteme. Sie hat zahlreiche Artikel und Bücher zu diesen Themen veröffentlicht und ist eine bekannte Stimme in der öffentlichen Debatte über Renten- und Sozialpolitik.
Christine Laudenbach ist Ökonomin und Professorin für Finanzwirtschaft an der Goethe-Universität und Leiterin der Abteilung Haushaltsfinanzierung am Leibniz-Institut für Finanzforschung SAFE in Frankfurt. Ihre Forschungsinteressen sind Verhaltensökonomie und Haushaltsfinanzen. Sie untersucht insbesondere die Triebkräfte der finanziellen Entscheidungsfindung privater Haushalte und Möglichkeiten, die Qualität dieser Entscheidungen zu verbessern, beispielsweise durch finanzielle Bildung, Finanzberatung oder Entscheidungshilfen.
Antoinette Weibel ist Ordinaria für Personalmanagement und Direktorin am Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitswelten an der Universität St. Gallen (HSG). Sie ist Präsidentin des Geschäftsleitenden Ausschusses des Instituts für Systemisches Management und Public Governance, Mitglied des Vorstandes des Instituts für Kommunikations- und Medienmanagement und des Instituts für Wirtschaftsethik der Universität St. Gallen. Weibel befasst sich in ihrer Forschung mit Vertrauensmanagement in Unternehmen, Corporate Trust, Stakeholdervertrauen und vertrauensbasierter Führung.
Ist der Untergang der Credit Suisse auch die Folge einer toxischen Unternehmenskultur?
Monika Bütler: Ich würde sagen, dass es vor allem Managementfehler waren. Und eventuell ein zu spätes Eingreifen der Behörden.
Oder einer Entmenschlichung?
Monika Bütler: Das ist schwierig zu sagen, ohne direkt Einblick zu haben. Ich denke: Der Untergang ist eher eine Folge eines gewissen Verlusts des Realitätssinnes.
Ist die Credit Suisse ein Einzelfall oder spiegelt er vielmehr ein Systemproblem der Finanzindustrie?
Antoinette Weibel: Die Finanzindustrie hat sich stark einer Führungskultur verschrieben, die Menschen behandelt, als wären sie «hinterlistig, faul, gerissen und in erster Linie darauf bedacht, den eigenen Nutzen zu maximieren». Solche Menschen können nur geführt werden, wenn man mit starken Anreizen und klaren Zielen arbeitet – so besagt es zumindest die Ideologie des sogenannten «Homo Oeconomicus», eines Nutzenmaximierers. Mögliche Nachteile eines solchen «Management by Boni» werden ignoriert.
Welche sind denn diese Nachteile?
Antoinette Weibel: Es geht um die Torheit, A zu belohnen und auf B zu hoffen. Mit anderen Worten: Solche Anreize, wie sie in diesem System geschaffen werden, produzieren gleichzeitig Fehlanreize.
Inwiefern?
Antoinette Weibel: Die Mitarbeitenden müssen sich auf das Mess- und Planbare konzentrieren statt auf wichtige Verhaltensaspekte. Dieses System lässt sich an verschiedenen Beispielen veranschaulichen. So würden Lehrpersonen nur für die Prüfung unterrichten, anstatt eine umfassende Bildung zu bieten; Chirurgen könnten unnötige Eingriffe durchführen, um Operationsquoten zu erfüllen; Banker gehen riskantes Verhalten ein, um Verkaufsziele zu erreichen.
Welche Rolle spielen interne Anreizstrukturen wie hohe Boni, Löhne oder Fringe Benefits?
Monika Bütler: Die sehr hohen Boni und Löhne dürften zuerst einmal Auswirkungen haben auf die Auswahl der Manager:innen. Und weil Erfolg erstens viele Dimensionen hat und zweitens schwierig messbar ist, erfüllen meiner Meinung nach die meisten Kompensationssysteme ihre Aufgabe nicht. Im besten Fall sind sie kompliziert und wirkungslos. Im schlechtesten verzerren diese Anreize die Anstrengungen des Managements in unerwünschte Richtungen. Zum Beispiel zu riskantem Verhalten.
Antoinette Weibel: Auf Unternehmensebene, insbesondere im Bereich der CEO-Löhne, können wir feststellen, dass gerade Optionsanreize mit betrügerischem Verhalten verbunden sind. Bei anderen flexiblen Lohnbestandteilen ist die Literatur noch unschlüssig, aber sie zeigt keineswegs nur erwünschte Effekte.
Wie heikel sind diese rein finanziellen Anreize kulturell?
Monika Bütler: Aus der Forschung weiss man, dass finanzielle Ziele und Anreize die intrinsische Motivation der Mitarbeitenden verdrängen können. Das ist bestimmt nicht förderlich für die Zusammenarbeit. In einer interessanten Arbeit wurde nachgewiesen, dass das kulturelle Umfeld der Banken unehrliches Verhalten fördern kann.
Antoinette Weibel: Finanzielle Anreize verdrängen die intrinsische sowie die soziale und moralische Motivation. Die intrinsische Motivation ist ein innerer Wunsch oder Antrieb. Durch die soziale Motivation werden Menschen angetrieben, Dinge zu tun, die für andere Menschen oder die Gesellschaft vorteilhaft sind. Im aktuellen System verändern sich oder verschwinden diese Antriebe – Geld wird zum einzigen Bezugspunkt. Im Volksmund nennen wir es Gier.
Und wie wirken sich solche Führungssysteme auf die Kultur aus?
Antoinette Weibel: Zum einen fühlen sich geldorientierte und auf Wettbewerb getrimmte Menschen stärker von einem solchen Führungsregime angezogen als Menschen, die lieber einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten möchten oder Zusammenarbeit vor Ellenbogenkultur setzen. Dass in Unternehmen, die nach solchen Führungssystemen funktionieren, dann vor allem Menschen arbeiten, die auf diese Systeme ansprechen, führt am Ende zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung: Die ursprüngliche, theoretische Annahme, dass Menschen nur arbeiten, wenn man ihnen eine Karotte – also Geld – vor die Nase hält, bestätigt sich und wird so zur Realität.
Warum ist insbesondere die Finanzwelt immer noch so ein männlich geprägtes System?
Christine Laudenbach: Finanzen sind im Allgemeinen ein Thema, das «männlich» besetzt ist. Das zeigt sich auch darin, dass sich weniger Studentinnen für die Finanzbranche interessieren als Studenten. Das hat auch etwas mit der Wahrnehmung von Moralvorstellungen und Familienfreundlichkeit in der Branche zu tun. Hinzu kommt, dass der Finanzbranche generell Misstrauen entgegengebracht wird. War eine Bankausbildung früher noch positiv besetzt, hat sich die öffentliche Wahrnehmung hier deutlich zum Negativen gewandelt.
Monika Bütler: Ja, bereits bei der Studienwahl sehen wir weniger Frauen in Ökonomik als Männer. Und selbst unter den forschenden Ökonominnen gibt es im Vergleich zu Fachrichtungen wie Arbeitsmarkt und Gesundheit nur wenige Frauen, die im Finanzsektor forschen. Aber es ist vermutlich auch eine Kombination von unterschiedlichen Präferenzen, Kultur und versteckten Hürden für Frauen. Wobei sich die letzten beiden Faktoren verstärken: Wenn die Kultur Frauen – und wohl auch sehr viele Männer! – abschreckt, dann trauen sich die Frauen weniger zu, und es werden noch weniger Frauen ins Banking gehen.
Inwiefern trägt das System dazu bei, dass es kaum Spitzenbankerinnen gibt?
Christine Laudenbach: Es fehlt, wie gesagt, schon an der Basis, bei den Studierenden. Auf dem Weg nach oben kommt hinzu, dass Frauen eher vor Verhandlungen zurückschrecken, loyaler und weniger wechselbereit sind. Sie möchten tendenziell gesehen werden und nicht sich zeigen müssen. Wenn sie es in diesem System überhaupt schaffen, dann brauchen sie länger bis an die Spitze.
Monika Bütler: Genau. Eine Kultur, die Frauen abschreckt und in der sie sich wenig zutrauen, sorgt nicht dafür, dass sie an die Spitzen kommen.
Braucht es einen Kulturwandel in der Bankenwelt?
Monika Bütler: Ich bin immer etwas skeptisch, wenn ein Kulturwandel gefordert ist – der lässt sich nicht so einfach verordnen. Aber wir brauchen eine transparentere und einfachere Regulierung, welche Exzesse erschwert. Ich bin, heute noch mehr als früher, eine Anhängerin der Anregungen der beiden Wirtschaftswissenschaftler Anat Admati und Martin Hellwig. Sie schlagen vor allem viel höhere Eigenmittelvorschriften, eine transparentere Rechnungslegung und einen adäquaten institutionellen Rahmen vor.
Christine Laudenbach: Mein Kollege Andrej Gill von der Universität Mainz hat hierzu ein ernüchterndes Experiment gemacht: Studierende haben in seiner Studie an einem Experiment zur Vertrauenswürdigkeit teilgenommen, und er hat sie über die Zeit beobachtet. Die Studierenden, die ihren ersten Job in der Finanzbranche hatten, haben in dem Experiment sechs Jahre zuvor weniger vertrauenswürdig agiert.
Was würde mehr Vielfalt bewirken?
Christine Laudenbach: Es gibt inzwischen ausreichend Studien, die belegen, dass Diversität einen positiven Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat – aber Diversität ist kurzfristig auch immer eine enorme Herausforderung. Wir müssen bereit sein, aus unserer Komfortzone herauszugehen. Das gilt vor allem für Führungskräfte. In einer Studie gaben Frauen an, dass sie ungern in Branchen arbeiten möchten, in denen ihr Geschlecht unterrepräsentiert ist – das ist in der Finanzbranche definitiv der Fall.
Monika Bütler: Ich bin keine Freundin von staatlich verordneter Vielfalt für private Firmen. Anders sehe ich es in öffentlichen Funktionen und in der Politik: Hier scheint mir essenziell, dass die Gesellschaft in ihrer Vielfalt repräsentiert wird. Die Frage ist nun: Wie privat ist der Bankensektor noch, wenn er so am Tropf des Staates hängt?
Wie wirken sich höhere Frauenanteile im Management aus?
Monika Bütler: Diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Wenn wir einen Zusammenhang zwischen Performance und Frauenanteil finden, dann kann die Ursache-Wirkungs-Kette in beide Richtungen gehen: Gute Firmen finden es einfacher, Frauen zu rekrutieren. Oder aber ein höherer Frauenanteil führt zu besseren Frauen.
Wie schafft die Bankenwelt eine solche Veränderung? Braucht es dazu Druck von aussen?
Christine Laudenbach: Manche Dinge regeln sich nicht von selbst. Ein Experiment von Kollegen aus Bonn und Exeter macht beispielsweise deutlich, dass Quotenregelungen insbesondere hochqualifizierte Frauen dazu motivieren, sich zu bewerben, die sich sonst vielleicht nicht dem Wettbewerb ausgesetzt hätten. Von daher denke ich, dass bestimmte Glaubenssätze sowohl auf der Arbeitgeber:innen-, aber auch auf der Arbeitnehmer:innenseite so tief verankert sind, dass es vielschichtige Ansätze und auch Einwirkungen von aussen braucht, um Dinge schneller ändern zu können.
Wie könnte eine wirkliche kulturelle Transformation in der Bankenwelt aussehen?
Monika Bütler: Eine nach Admati/Hellwig konstruierte Bankenwelt wird automatisch sicherer, «langweiliger» und vermutlich – als Konsequenz – auch inklusiver.
Warum kommentieren und analysieren den Untergang der Credit Suisse fast ausschliesslich Männer?
Monika Bütler: Aus denselben Gründen wie oben: Es hat zu wenig Frauen, die im Finanzsektor arbeiten oder forschen. Und dazu kommt, dass Medienarbeit für Frauen unangenehmer ist als für Männer. Frauen werden mehr angefeindet und weniger ernst genommen – aber das wisst ihr selber ja am besten.
Und wie. Danke für das Gespräch.

.jpg-.jpg)