Die Frauenhäuser stehen kurz vor der Überlastung, berichteten verschiedene Medien vergangene Woche: Viele sind bereits voll und müssen Frauen, die Schutz suchen, in andere Kantone verweisen. Dass die Schutzunterkünfte kaum noch freie Plätze haben, ist nichts Neues: Vergangenes Jahr lag die durchschnittliche Belegung der meisten Häuser nur knapp unter hundert Prozent, bei einigen lag sie sogar monatsweise darüber. Das entspricht einer Steigerung von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Gewalt gegen Frauen nimmt stetig zu, das zeigen auch die Zahlen des Bundes: Im Jahr 2022 wurden fast 20'000 Straftaten im Bereich von häuslicher Gewalt registriert. Dies entspricht einem Anstieg von 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und trotzdem fehlt es noch immer an dringend benötigten Ressourcen – auch finanziell.
Die Schweiz missachtet ihre Verpflichtung
Genügend Geld für den Kampf gegen häusliche Gewalt ist kein «nice to have», im Gegenteil: Mit der Istanbul-Konvention hat sich die Schweiz dazu verpflichtet, Gewalt an Frauen resolut zu bekämpfen. Dazu gehört explizit auch das Ausbauen von Schutzangeboten wie beispielsweise Frauenhäusern sowie deren langfristige Finanzierung.
Die Schweiz lahmt hier jedoch, wie so oft bei Gleichstellungsthemen. Im Oktober 2022 wurde sie für ihr ungenügendes Engagement gerügt. GREVIO, ein Überwachungsgremium internationaler Expert:innen, hat damals einen Bericht veröffentlicht, der grosses Verbesserungspotenzial im Kampf gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt aufzeigt: Die Schweiz stelle nach wie vor «nicht genügend Mittel» zur Verfügung, was unter anderem zu einem Mangel an Krisenzentren und Betreuungsmöglichkeiten für Opfer von häuslicher und sexualisierter Gewalt führt.
Zum Vergleich: Für die Rettung der Credit Suisse wurden quasi über Nacht Milliarden von Franken bereitgestellt. Frauenhäuser sind auf private Spenden angewiesen, weil sie unterfinanziert sind. Und dies, obwohl NGOs und Fachpersonen seit Jahren Alarm schlagen.
Gewalt gegen Frauen wird privatisiert
Dass der Bund zu wenig Geld für den Kampf gegen Gewalt an Frauen zur Verfügung stellt, trägt zudem wesentlich dazu bei, dass sie weiterhin als Privatsache angesehen wird. Ansonsten würden sich unsere Regierung und die Politik doch umfassender darum kümmern, oder?
Man kann also weiterhin getrost wegsehen, wenn man die Nachbarin mit einem blauen Auge im Treppenhaus antrifft. Kann der Arbeitskollegin ohne allzu schlechtes Gewissen glauben, wenn sie sagt, ihr Mann meine das eigentlich gar nicht so, wenn er sie jeden Abend bedroht. Kann weghören, wenn die Frau am Nebentisch im Café ihrer Freundin erzählt, dass ihr Partner ihr schon wieder das Bankkärtli weggenommen hat und sie ihn noch immer nicht verlassen kann.
Bloss: Gewalt an Frauen und Kindern ist keine Privatsache. Der Bund hat eine Verpflichtung, die er seit Jahren vernachlässigt. Das Parlament verstärkte dies bis vor Kurzem verstärkt. Während der Coronapandemie schickte beispielsweise der Ständerat eine landesweit geplante Präventionskampagne für Sexismus bachab. Die Schweiz habe aufgrund der Pandemie zu wenig Geld dafür, zudem sei der Staat «nicht für alles zuständig».
Zu wenig, zu spät?
Hier hat das Parlament aber dazu gelernt und im Frühling 2022 ein erstes Budget für eine gesamtschweizerische Präventionskampagne gegen sexualisierte, häusliche und geschlechtsbezogene Gewalt angenommen – Ende Jahr stehen allerdings noch die Budgetdebatten bevor. Wann und vor allem wie viel Geld gesprochen wird, ist also noch nicht klar.
Entsprechende Bestrebungen sind also durchaus da: Der Bund veröffentlichte 2021 einen Plan für den Umgang mit häuslicher Gewalt; die Umsetzung – und die Finanzierung – liegen aber bei den Kantonen. Auch die konkreten Massnahmen sind schwammig gehalten: «Die Kantone verpflichten sich, ihre Anstrengungen fortzusetzen, um eine ausreichende Anzahl von Plätzen für Opfer häuslicher Gewalt in Schutzunterkünften zu gewährleisten und eine angemessene Finanzierung sicherzustellen», heisst es etwa. Wie die Kantone die Finanzierung sicherstellen sollen, wird nicht definiert.
Auch wichtige Massnahmen wie eine schweizweite 24-Stunden-Beratung bei Gewalt, Präventionskampagnen oder Krisenzentren sind für die nächsten Jahre geplant. Fachpersonen bemängeln aber: Bund und Kantone stellen viel zu wenig Geld für die Umsetzung zur Verfügung. So würden diese Massnahmen möglichst billig statt möglichst gut umgesetzt. In einigen Kantonen ist gar eine Zusammenarbeit mit der «Dargebotenen Hand» geplant. Anstelle von Fachpersonen kümmern sich dann ungeschulte Freiwillige um die Schutzbedürftigen.
Spanien machts vor
Dass es auch anders ginge, beweist ein Blick über die Landesgrenze hinaus: Spanien hat den Kampf gegen Gewalt an Frauen institutionalisiert. Dort wird das entsprechende Engagement als Regierungsauftrag angesehen, und das Land steht auf der OECD-Liste der Länder, die Gender Budgeting fördern. Die Finanzierung von Frauenhäusern erfolgt vollständig durch den Staat, Präventionsmassnahmen werden jährlich ausgebaut. Diese Bemühungen zeigen Wirkung: Die Anzahl der Fälle von häuslicher Gewalt nimmt von Jahr zu Jahr ab.
Es ist löblich, dass in der Schweiz entsprechende Angebote und kleine Budgets in Planung sind. Aber es braucht zusätzlich raschere Möglichkeiten für die Umsetzungen der Massnahmen und vor allem mehr Geld. Und eine Politik, die dafür einsteht. Eine Möglichkeit, dies anzukurbeln, haben wir mit unserem Stimmzettel im Herbst selbst in der Hand.
Viele Frauenhäuser können Notfälle bereits heute nicht mehr stemmen und müssen die Betroffenen in andere Kantone schicken. Das kann im schlimmsten Fall Leben kosten: Die für die Frau gefährlichste Zeit, wenn sie einer gewaltvollen Beziehung entkommt, ist der Moment, in dem sie vor dem Täter flieht. Oft nur mit dem Nötigsten ausgerüstet und dringend auf sofortigen Unterschlupf angewiesen. Die Reise in einen anderen Kanton kann sie bereits daran hindern, diesen Schritt zu unternehmen, sei es aus zeitlichen oder finanziellen Gründen.
Laut WHO ist eines der grössten Gesundheitsrisiken für Frauen weltweit die Gewalt, die sie innerhalb ihrer Partnerschaften erleben. So bleibt die grösste Verantwortung, die der Staat im Kampf gegen Gewalt an Frauen aktuell trägt, vor allem eine: Die Verantwortung für die Leben derjenigen, die Schutz suchten – und ihn nicht mehr rechtzeitig gefunden haben.

.jpg)

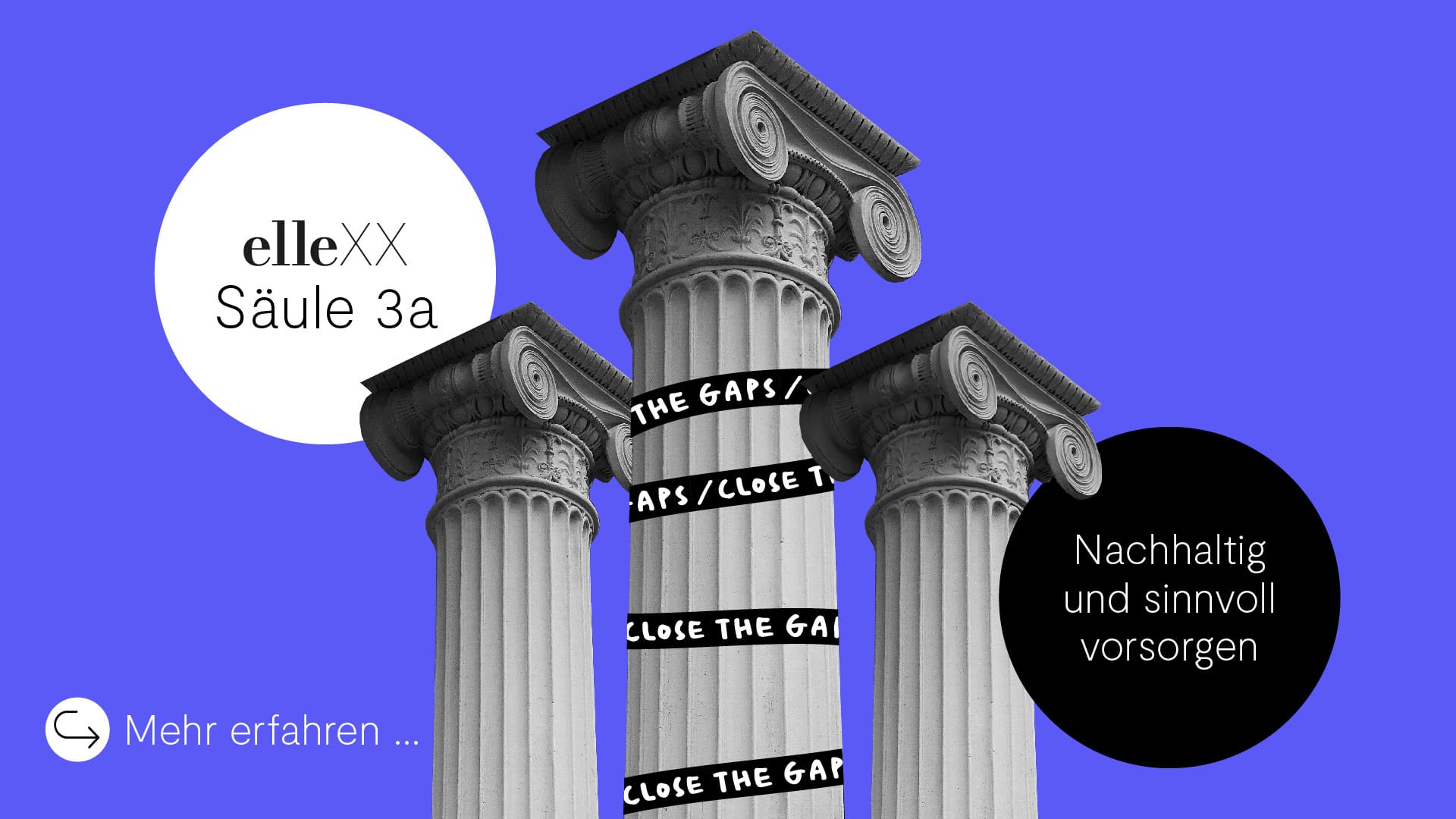
.jpg-.jpg)




