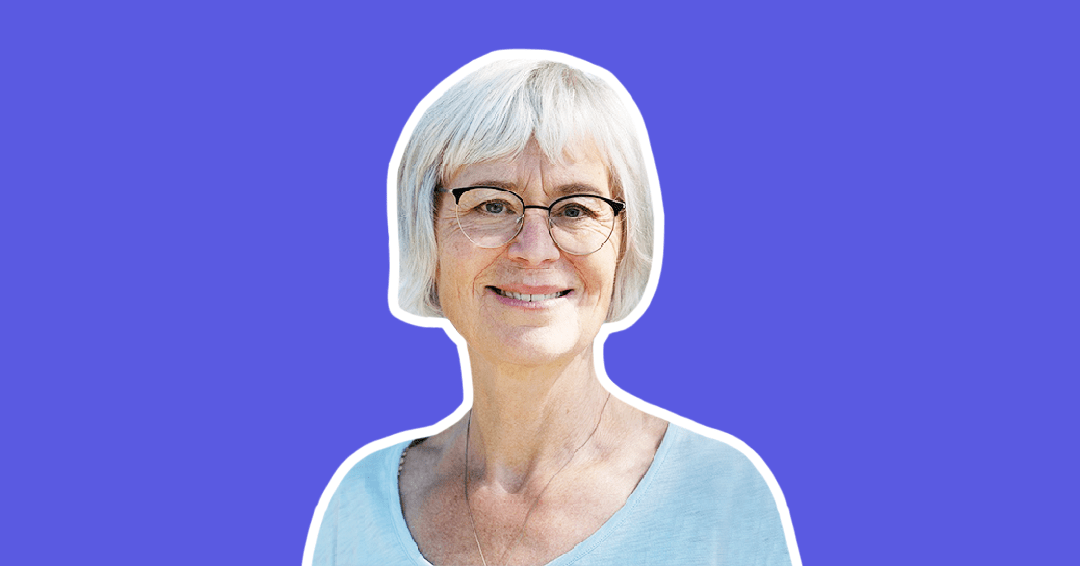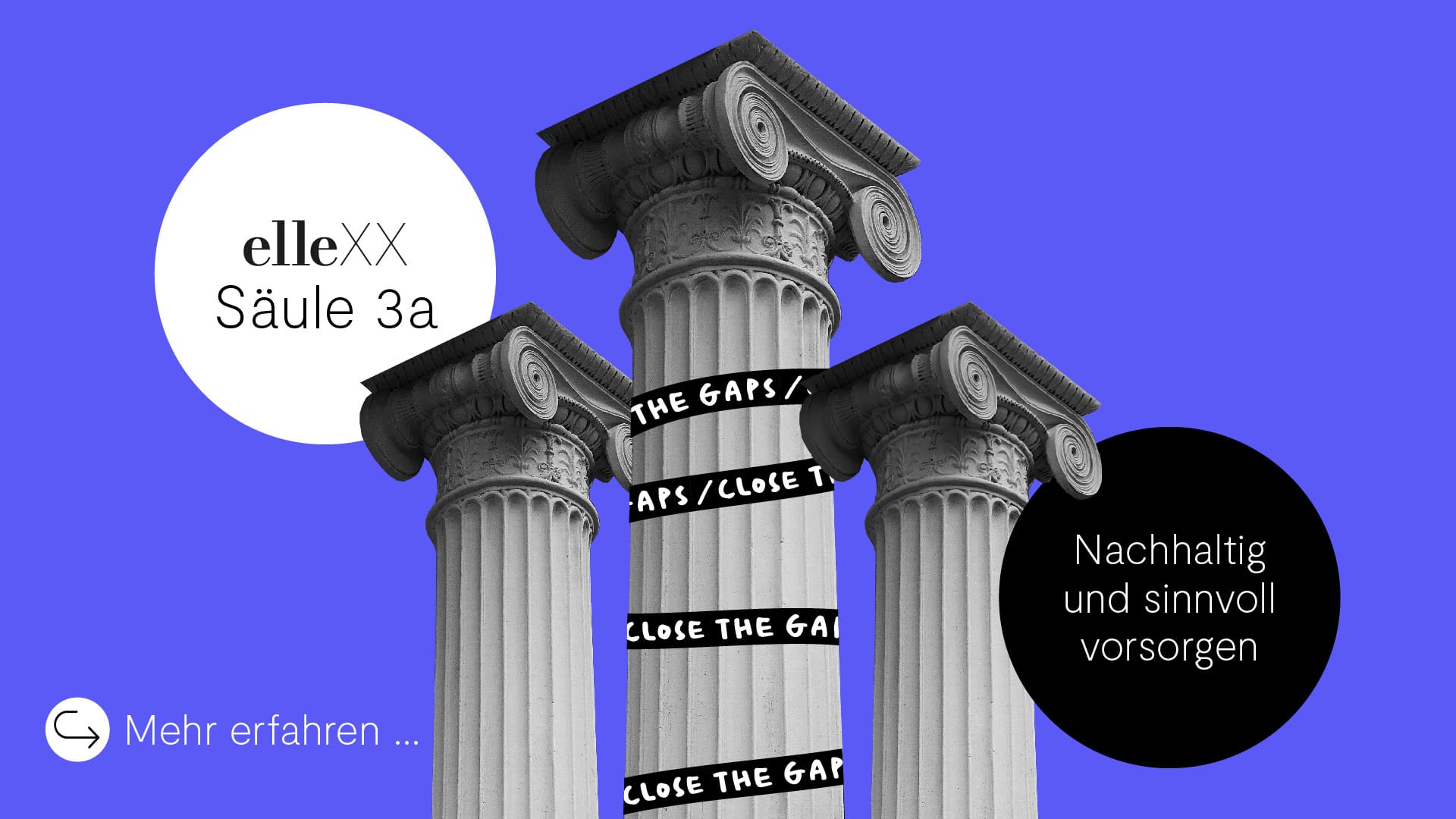«Haben Sie ein bisschen Münz für mich?», fragte mich kürzlich eine Frau an der Bahnhofstrasse Zürich, während ich auf mein Tram wartete. Ihre müden Augen schauten mich erwartungsvoll an. Sie trug keine Schuhe, ihre Zehennägel waren schwarz verfärbt. Ich suchte in meinem neuen Max-Mara-Mantel, für den ich mich in diesem Moment beinahe schämte, nach etwas Kleingeld.
Sichtbare Armut ist in der Schweiz eher selten. Im Verborgenen arm zu sein, ist hingegen verbreiteter, als es die Bahnhofstrasse an diesem Dezemberabend auf den ersten Blick vermuten lässt: Gemäss dem Hilfswerk Caritas sind in der Schweiz 1.3 Millionen Menschen arm oder davon bedroht, arm zu werden. Jeder elfte Mensch lebt hierzulande in Armut. Betroffene Einzelpersonen leben von weniger als 2279 Franken im Monat, Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern müssen mit weniger als 3964 Franken auskommen. Dieses Geld muss reichen für Miete, Kinderbetreuung, die Krankenkasse , Lebensmittel und Kleidung, Energiekosten, Medikamente, Toilettenartikel, Handyabo, Internet, Fahrkosten und Hobbies. So manche Zürcher:innen geben bereits für das Wohnen mehr als das gesamte Monatsbudget von Armutsbetroffenen aus.
Ich selbst gehöre heute zum unteren Mittelstand. Ich habe gerade so viel Geld, dass ich mir neben den Lebenskosten, der 3. Säule und den Campingferien auch noch den neuen Max-Mara-Mantel im Ausverkauf leisten kann. Nach der Trennung von meinem Ex-Mann aber war auch meine finanzielle Situation prekär. Ich war gerade mal 28 und Mutter eines Kleinkindes, hatte kein Erspartes und keine vermögenden Eltern und war als Buchhändlerin in einer Tieflohnbranche tätig.
Zudem lebte ich in einer ländlichen Region, eine Kita für meinen Sohn gab es dort nicht, weshalb ich nur in einem kleinen Pensum arbeitete. Trotz Kinder- und Frauenalimente von meinem Ex-Mann wäre mir beinahe nur der Gang zum Sozialamt oder der Wiedereinzug samt dem Kind bei meinen Eltern geblieben.
Stattdessen entschloss ich mich, mit meinem Sohn in die Stadt zu ziehen, wo ich für ihn einen Platz in einem subventionierten Tageskindergarten fand. Meine Schwester und eine Bekannte halfen mir, eine günstigere Wohnung zu finden. Eine Freundin ermutigte mich dazu, mich für Jobs ausserhalb der Buchbranche zu bewerben, um besser zu verdienen. So führte eines zum anderen, und ich erhielt die Zusage für eine gut bezahlte Stelle in einem grossen Unternehmen. Bald konnte ich auf die Frauenalimente von meinem Ex-Mann verzichten, für meinen Lebensunterhalt selbstständig aufkommen und ein zwar bescheidenes, aber immerhin ein Leben ohne Angst vor der nächsten Rechnung führen.
Bin ich deshalb eine Referenz für den Weg aus der Armut? Bitte nicht.
Denn was ich damals hatte, war unter anderem das Glück, resilient zu sein. Resilienz ist die Fähigkeit, Tiefpunkte und Krisen zu überwinden, gar daran zu wachsen. Doch nicht alle Menschen verfügen über die gleiche Widerstandskraft. Ausserdem hatte ich ein unterstützendes soziales Umfeld und gute Freundschaften. Viele Menschen sind in Krisen allein. Ich blieb zwar psychisch und physisch gesund, die Zeit von damals hat aber auch bei mir ihre Spuren hinterlassen. Die Belastungen als alleinerziehende Mutter haben mich viel Energie gekostet, das spüre ich in zeitweiliger Erschöpfung immer noch. Auch war es mir bis heute nicht möglich, viel Geld anzusparen oder die Lücken von damals in der Altersvorsorge auszugleichen.
Zehn Jahre später wurde ich zudem nochmals Mutter. Meine Tochter kam mit einer Behinderung zur Welt, was erneut mit viel Anstrengung und Care-Arbeit verbunden ist. Nur weil mein Partner und ich es heute zusammen stemmen, bin ich nicht zum zweiten Mal in finanzielle Not oder ein Burnout geraten.
Wohl auch deswegen konnte ich die Bettlerin an diesem regnerischen Abend an der Zürcher Bahnhofstrasse nicht einfach ignorieren. Zu präsent ist mir die Zeit, als ich selbst fast den Gang zum Sozialamt hätte machen müssen. Zu gross ist mein Verständnis für diejenigen, die es nicht aus eigener Kraft schaffen oder wieder in die Armut zurückfallen durch neue Belastungen.
Doch arme Menschen erfahren in unserer Gesellschaft oft Verachtung, sie werden ignoriert oder sogar tätlich angegangen. Auch weil wir in Helvetien von klein auf lernen: Wer arm ist, ist selbst schuld. Hat sich nicht genügend angestrengt, hat versagt, ist faul oder dumm. Auch wenn das oft nicht mehr ist als ein Ammenmärchen. In der Schweiz leben unter anderem über 155'000 sogenannte «working poor»: Arbeitnehmende, die trotz eines oder mehrerer Jobs mit weniger als dem Existenzminimum auskommen müssen.
Beschäftigt sind sie oft Tieflohnbranchen. Die meisten davon im Detailhandel, der Gastronomie und Hotellerie. Zwei Drittel davon sind Frauen. Die Teuerung, die auf hohem Niveau stagniert, hat die Situation zusätzlich verschärft. Vor allem die aktuellen hohen Energiekosten belasten Haushalte mit wenig Budget enorm. Auch ich habe vor ein paar Wochen die Heizkostenabrechnung erhalten, die tausend Franken höher ist als die der letzten Heizperiode. Dazu stiegen die Krankenkassenprämien und die Lebensmittelpreise – als ich noch alleinerziehend war, hätte ich diese Zusatzkosten unmöglich stemmen können.
Die Politik reagiert leider nur zögerlich. Dabei erklärte die Caritas Schweiz bereits im Frühjahr 2022 gegenüber SRF, dass immer mehr Menschen in ihren Märkten einkaufen. Von Armut betroffene Menschen könnten nicht noch mehr sparen, sondern nur verzichten, hiess es im Beitrag. So würden sie zum Beispiel Mahlzeiten auslassen oder auf Besuche bei Ärzt:innen oder Therapeut:innen verzichten. Wohl auch deshalb sterben Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, im Durchschnitt bis zu zehn Jahre früher als Menschen aus der oberen Einkommensklasse.
Und was ist die Lösung? Für mich ist klar, egal ob ich heute dem Mittelstand angehöre oder damals am Existenzminimum lebte: Es braucht eine Politik, die sich für die Chancengleichheit aller Menschen einsetzt. Zum Beispiel an den Schulen, wo noch immer vor allem Kinder aus akademischen Familien gefördert werden und ans Gymnasium gelangen, Arbeiter:innen-Kinder hingegen um ein Vielfaches mehr eine Lehre in einer Tieflohnbranche machen. Es braucht eine Politik, die für faire Löhne in diesen Branchen sorgt und damit gegen das Phänomen «working poor» vorgeht. Es braucht die Anerkennung der Care-Arbeit als Wirtschaftszweig und bezahlbare und flexible Kinderbetreuung – nur so kommen viele Mütter aus der Armutsfalle.
Damit ist es in meinen Augen aber noch nicht getan. Es braucht auch individuelle Veränderung. Zum Beispiel eine Gesellschaft, die miteinander solidarisch ist, die mit ihren Mitmenschen freundlich, empathisch und bestärkend umgeht – auch in Krisen. Denn was wir oft vergessen: Unsere individuelle Situation kann sich jederzeit ändern. Und dann brauchen wir einander oft mehr, als wir in unseren aktuellen Situationen jeweils glauben wollen.
«Haben Sie nun etwas Münz?», fragte mich die Frau noch einmal. Endlich fand ich ein paar Franken in meinem Mantel. «Es ist für die Notschlafstelle», erklärte sie, und sie führte aus, dass wenn sie genügend Geld zusammenbringe, sie ein Zimmer nehme, das sie abschliessen kann. Ich gab ihr zehn Franken und sagte, dass ich das gut verstehe. Als mein Tram einfuhr, winkte sie mir zu und rief laut: «Tschüss, du Liebe.» Ich winkte aus dem Tram zurück und fragte mich, was wohl ihre Geschichte war. Vielleicht wird sie mir beim nächsten Mal davon erzählen – oder ich ihr aus meiner.
Marah Rikli ist freie Autorin, Buchhändlerin und Mutter zweier Kinder. Als Kolumnistin für das Lehrpersonenmagazin «Rundgang» schreibt sie über das Leben mit ihrer Tochter, die eine Behinderung hat. Sie publiziert regelmässig Artikel für den Mamablog des «Tages-Anzeigers» und veröffentlichte Beiträge im «Magazin», in der «SonntagsZeitung», der «Republik», der «NZZ», im «Wir Eltern» und der «Aargauer Zeitung». Ihre Schwerpunkte: Inklusion, LGBTQIA+, Feminismus, Mental Health und Erziehung. Im Debattierhaus «Karl der Grosse» moderiert sie seit Herbst 2022 die Talk-Reihe «Karl*a der*die Grosse» und spricht dort mit ihren Gesprächspartner:innen über Tabuthemen.
Zum Thema ihrer ersten Kolumne empfiehlt Rikli die Bücher «Wie viel» von Mareice Kaiser und «Zugang verwehrt» von Francis Seeck.