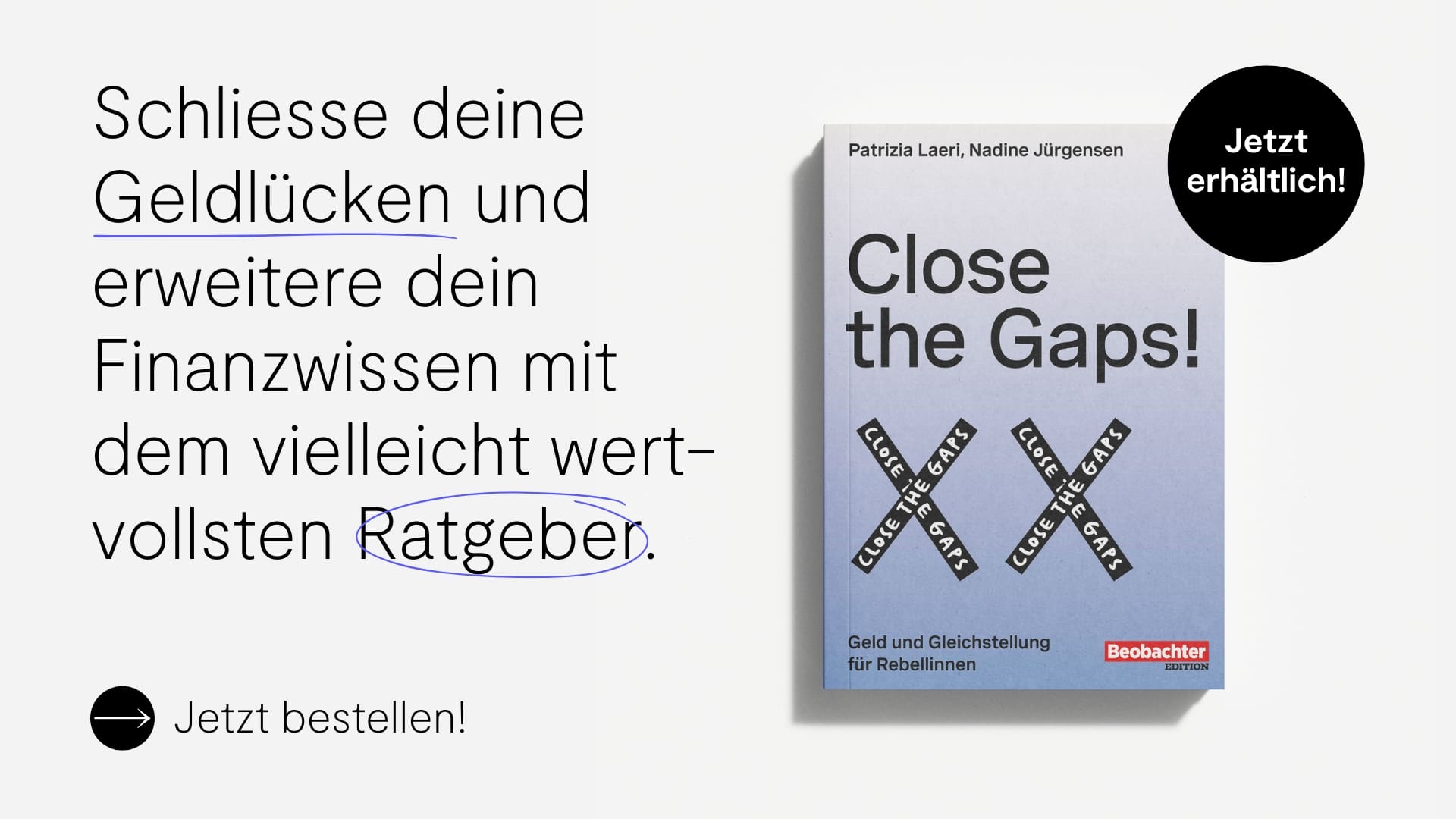Ich weiss, wie es ist, mit wenig Geld in der reichen Schweiz zu leben. Mit 25 stehe ich vor einem Regal im Lebensmittelladen. Es ist Anfang Monat, und ich habe fast kein Geld mehr. Plötzlich kommt mir ein Gedanke: Könnte ich vielleicht das eine oder andere unbemerkt in meiner Tasche verschwinden lassen? Eine Freundin hat mir gezeigt, wie.
Doch schnell verwerfe ich den Gedanken ans Stehlen wieder, obwohl ich am Existenzminimum lebe.
Gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) waren 2023 8,1 Prozent der Schweizer Bevölkerung von Armut betroffen. Dies sind etwa 708’000 Menschen. Die Schweiz hat sich im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UNO) das Ziel gesetzt, die Zahl der von Armut betroffenen Menschen signifikant zu reduzieren.
Wer in Not gerät, hat laut Bundesverfassung Anspruch auf finanzielle Unterstützung vom Staat. Abhängig von der jeweiligen Situation gibt es verschiedene Sozialleistungen: die Arbeitslosenversicherung, die Invalidenversicherung, die Ergänzungsleistungen oder die Sozialhilfe.
Junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren haben ein erhöhtes Armutsrisiko. Viele befinden sich in Ausbildung oder in Beschäftigungsverhältnissen mit niedrigen Löhnen und unsicheren Arbeitsbedingungen. Andere haben aufgrund familiärer oder gesundheitlicher Schwierigkeiten keinen stabilen Rückhalt und sind auf staatliche Hilfe angewiesen. Für die Schweizerische Konferenz der Sozialhilfe (SKOS) ist es von besonderem Interesse, das Armutsrisiko junger Erwachsener zu reduzieren. Wenn diese dauerhaft auf Sozialhilfe angewiesen sind, entstehen langfristig hohe Kosten für die gesamte Gesellschaft.
Jaëls Geschichte
Die 21-jährige Studentin Jaël* erfuhr als Teenagerin, dass ihre Eltern IV-Leistungen beziehen. Sie wusste von Kindesbeinen an, dass beide Eltern nicht arbeiten, und fragte sich daher oft, woher das Geld kam. «Ich bin damit aufgewachsen, dass man mit Geld sorgsam umgehen muss», erzählt sie.
Dieses Bewusstsein hat sie geprägt: Heute neigt Jaël dazu, besonders sparsam zu sein, und plant ihre Ausgaben stets im Voraus. Über ihre finanzielle Situation zu sprechen, fiel ihr lange Zeit nicht leicht – insbesondere in ihrem persönlichen Umfeld hatte sie Hemmungen, das Thema anzusprechen. Inzwischen kann sie mit Freund:innen offen darüber sprechen.
Heute studiert Jaël Geschichte an der Universität Zürich. Vom Kanton erhält sie monatlich rund 600 Franken an Stipendien für ihre Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten.
Sie wohnt weiterhin bei ihren Eltern und legt aufgrund ihrer finanziellen Situation grossen Wert auf ein Sparkonto. Zwar ist nicht viel drauf, aber hin und wieder gönnt sie sich mit diesem Geld Ferien: «Ich achte darauf, dass die Unterkünfte günstig sind.»
Nach ihrem Studium möchte Jaël Lehrerin werden. «Ich hoffe, dass diese staatliche Stelle mir finanzielle Sicherheit gibt.»
Senkas Geschichte
Die 22-jährige Senka*, die sowohl Schweizer als auch serbische Wurzeln hat, ist hier aufgewachsen. Ihre Kindheit war geprägt von finanziellen Schwierigkeiten. «Ich habe beispielsweise nie Taschengeld erhalten.» Ihre Mutter lebte am Existenzminimum, ihr Vater ist früh gestorben. Zu Hause war die Situation oft angespannt.
In ihrer Jugend suchte Senka nach Halt, lief mehrmals von zu Hause weg und verbrachte die Nächte bei fremden Männern. «Wenn ich mit ihnen rumgemacht habe, durfte ich dort schlafen», erzählt Senka.
Zweimal begann sie eine Lehre, musste diese aber beide Male abbrechen, denn die psychischen Belastungen waren zu gross. Mit 18 Jahren beantragte Senka Sozialhilfe. Zwei Jahre später zog sie in ein begleitetes Wohnen und absolvierte ein Bewerbungstraining. Sie startete einen weiteren Ausbildungsversuch, doch auch dieser scheiterte. Seitdem ist sie in einer niederschwelligen Tagesstruktur beschäftigt, die ihr hilft, einen stabilen Alltag aufzubauen.
Das Sozialamt deckt ihre Wohn- und Betreuungskosten und Krankenkasse, zudem erhält sie monatlich 800 Franken für Lebensmittel, Kleidung und den öffentlichen Verkehr.
Einen grossen finanziellen Druck spürt Senka durch die Schulden aus der Vergangenheit, vor allem durch häufiges Schwarzfahren. Pro Monat muss sie rund 200 Franken zurückzahlen, da das Sozialamt Schulden nicht übernimmt. Dadurch bleibt ihr kaum Geld für den Alltag, insbesondere nicht für Freizeitaktivitäten.
Wie ihre Zukunft aussehen wird, ist ungewiss. Im Moment hat Senka nur ein Ziel: Sie will «überleben».
Warum geraten junge Menschen in finanzielle Not?
Diese beiden Geschichten zeigen, dass finanzielle und berufliche Unterstützung entscheidend für die soziale und auch berufliche Integration junger Menschen sind. In der Schweiz gibt es bereits einige Massnahmen und Programme (siehe Infobox am Textende).
Es gibt zahlreiche Faktoren, die junge Erwachsene in finanzielle Schwierigkeiten bringen können. «Kinder und junge Erwachsene, die in einem Haushalt mit finanziellen Schwierigkeiten aufwachsen, haben auch später ein erhöhtes Risiko, in prekären Umständen zu leben», sagt Aline Masé von der Fachstelle Sozialpolitik der Caritas Schweiz.
In der Forschung wird dieses Phänomen als «soziale Vererbung von Armut» bezeichnet. Dass weder die Gesellschaft noch die Politik bislang wirksame Lösungen gefunden haben, um diese Weitergabe von Armut über Generationen hinweg zu durchbrechen, ist laut Caritas Schweiz ein grosses Problem. «In den letzten 25 Jahren wurde die Forderung nach Familien-Ergänzungsleistungen oder einer bundespolitischen Aktivität in Bezug auf Familienarmut mehrfach abgelehnt», sagt Masé. Die Begründung sei immer dieselbe: Die Kantone seien zuständig. Daher werde sich Caritas verstärkt auf die Armutsbekämpfung auf kantonaler Ebene konzentrieren.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist laut Masé die Chancengleichheit im Bildungssystem. Kinder aus weniger privilegierten Familien haben es schwerer, einen erfolgreichen Bildungsweg einzuschlagen und den Übergang von der Schule ins Berufsleben zu meistern. Auch alleinerziehende junge Mütter sind stark von Armut betroffen, zeigt eine Studie der Universität Bern im Auftrag von Caritas. Ebenso haben Menschen mit psychischen oder physischen Erkrankungen oft Schwierigkeiten, eine stabile berufliche Existenz aufzubauen und zu erhalten.
Meine Geschichte
Ich bin Denise (25) und lebe mit Depressionen, Borderline und Trauma. Während der Coronapandemie musste ich mein Journalismus-Studium abbrechen. Nach einem Klinikaufenthalt bin ich in ein begleitetes Wohnen gezogen und erhalte finanzielle Unterstützung vom Sozialamt.
Mein Einkommen liegt, wie auch das meiner Mitbewohnerinnen, zwischen 800 und 1000 Franken pro Monat. Viele von uns sind zusätzlich verschuldet. Das Honorar, das ich als Journalistin verdiene, muss ich ans Sozialamt abgeben. Seit einem Jahr habe ich einen geschützten Arbeitsplatz in einer Stiftung, mit dem Ziel, in Zukunft wieder eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt zu finden.
- Einkommen: Etwa 1000 Franken Sozialhilfe pro Monat, kein Lohn. Sozialamt zahlt Krankenkasse, begleitetes Wohnen und Arbeitsintegration.
- Fixkosten: Handy-Abo, ÖV-Abo.
- Übrige feste Ausgaben: Essen, Hygiene- und Kosmetikartikel, Schulden abzahlen (ca. 200 Franken pro Monat), Netflix-Abo.
- Was bleibt: ca. 150 Franken pro Monat für Freizeit.
Aus dieser Situation herauszukommen, ist eine grosse Herausforderung. Dennoch bin ich dankbar für die Unterstützung, die mir auf meinem Weg geboten wird. Niemand sollte sich für seine finanzielle Lage schämen müssen. Als junge Erwachsene müssen wir offen darüber sprechen können und uns frühzeitig Unterstützung holen.
Es fällt mir heute nicht leicht, meine Situation transparent zu machen. Ich mache das, weil ich mir wünsche, dass wir endlich das gesellschaftliche Stigma gegenüber Menschen mit psychischen Belastungen und solchen, die einen anderen Weg gehen müssen, überwinden. Besonders in einer Gesellschaft, die so stark auf Leistung ausgerichtet ist wie die unsere, sollte mehr Verständnis und Akzeptanz herrschen.
- Betreutes oder begleitetes Wohnen: Das Sozialamt oder die IV übernehmen die Finanzierung von Wohnangeboten für junge Erwachsene in herausfordernden Lebenssituationen. Freie Wohnplätze findest du auf https://meinplatz.ch/de.
- Kostenlose psychologische Beratung: Pro Mente Sana oder Pro Juventute bieten telefonische Unterstützung für (junge) Menschen mit psychischen Belastungen.
- Berufliche Integration: Vorlehren, Erstausbildung und Stipendien helfen jungen Erwachsenen, langfristig finanziell unabhängig zu werden.
- Schuldenberatung und Budgethilfe: Das Hilfswerk Caritas Schweiz bietet Unterstützung beim Umgang mit finanziellen Problemen.
- Soziale Teilhabe: Mit der Kulturlegi erhältst du Vergünstigungen für Kultur, Sport, Bildung und Gesundheit.
*Namen der Redaktion bekannt.
Ja, das unterstütze ich!
Weil Gleichstellung auch eine Geldfrage ist.
Wie wär’s mit einer bezahlten Membership?
MembershipOder vielleicht lieber erst mal den Gratis-Newsletter abonnieren?
Gratis NewsletterHilf mit! Sprich auch Du über Geld. Weil wir wirtschaftlich nicht mehr abhängig sein wollen. Weil wir gleich viel verdienen möchten. Weil wir uns für eine gerechtere Zukunft engagieren. Melde Dich bei hello@ellexx.com
Schicke uns deine Frage: