Über Geld spricht man nicht? Falsch. Im Money Talk tun wir genau das. Heute mit Veronika Hutter, Geschäftsführerin von Pro Pallium. Die Stiftung setzt sich für Familien von unheilbar kranken Kindern ein.
Ein Kind in einer palliativen Situation zu haben, bedeutet: Es könnte sterben. Da stellt sich die Frage: wie mit dem Unvorstellbaren umgehen? Ein Gespräch über das würdevolle Ende von noch viel zu jungen Menschen. Und wer dafür bezahlt.
Du bist Geschäftsführerin von Pro Pallium. Die Stiftung entlastet Familien mit schwerstkranken Kindern. In was für einer Situation befinden sich solche Familien?
Die Familien sind emotional, organisatorisch und physisch enorm belastet. Im schlimmsten Fall wird das eigene Kind sterben. Dabei müssen Eltern auch im Alltag funktionieren: Sie müssen die Versorgung ihres erkrankten Kindes managen, den Job bezwingen, sich aber auch um die gesunden Geschwisterkinder kümmern – das ist eine Aufgabe, der eigentlich niemand gewachsen ist.
Ihr schenkt den Familien vor allem Zeit. Welche Zeit fehlt den betroffenen Familien?
Eltern fehlt es insbesondere in den ersten Jahren mit einem Kind immer an Zeit. Wir versuchen zu helfen, damit Zeit zum Durchatmen bleibt. Die Eltern wissen: «Jetzt kommt eine Freiwillige von Pro Pallium und unternimmt etwas mit meinem Kind. Und wir haben Zeit, um vielleicht einfach mal spazieren gehen zu können.» Zudem vernetzen wir sie mit Organisationen wie Kinderspitex oder Sozialarbeit.
Es gibt erst ein stationäres Kinderhospiz in der Schweiz, zwei weitere sind geplant. Die Finanzierung ist schwierig und erfolgt über private Spendengelder. Warum tut sich die Schweiz hier so schwer mit Subventionen?
Ich glaube, das Thema «Sterben bei Kindern» ist ein grosses Tabu. Wenn ich Leuten erzähle, wo ich arbeite, dann ist die Stimmung direkt im Keller. Geld, Trauer und kranke Kinder – darüber möchte niemand reden. Ich verstehe das. Ich bin selbst Mama. Wenn eine von uns betreute Familie ihr Kind verliert, dann muss ich mich auch sammeln und mir mental sagen, dass mein Kind daheim ist und es ihm gut geht. Trotzdem ist es wichtig, dass wir uns alle lautstark für die todkranken Kinder einsetzen. Denn deren Eltern haben meist keine Kraft dafür. Übrigens: Pro Pallium ist kein stationärer, sondern ein ambulanter Kinderhospizdienst, wir besuchen und entlasten die Familien also in ihren eigenen vier Wänden. Ein grosser Teil der rund 10’000 betroffenen Familien in der Schweiz möchte sein schwerstkrankes Kind zu Hause betreuen.
Redet ihr mit den Familien über Finanzen?
Das kommt darauf an, wie offen sie dafür sind. Manche fragen nach finanzieller Hilfe, auch wenn wir ihnen diese nicht anbieten können. Wir unterstützen die Familien insofern, als dass wir sie vernetzen oder mit ihnen eine Budgetplanung machen.
Als junge Frau hast du deine Karriere auf einer Bank gestartet. Wie bist du denn da gelandet?
Ich hatte schon immer ein Interesse für Wirtschaft und Banken. Danach war es eher Zufall. Die suchten eine Auszubildende, ich suchte eine Lehrstelle.
Wolltest du einfach viel verdienen?
Ein Sicherheitsnetz war mir schon damals wichtig. Obwohl ich in meinen 20ern durchaus auch ein paar unüberlegte Käufe und Investitionen getätigt habe. Es ist nicht so, dass die Ausbildung allein einen dazu bringt, besonders vernünftig mit Geld umzugehen. Es braucht auch die nötige Lebenserfahrung.
Mittlerweile arbeitest du in einer Hilfsorganisation. Ein Kulturschock?
Ja, definitiv. Ich bin aus dem Banken- und Steuerwesen zufällig in die Philanthropie gekommen. Jetzt bin ich Geschäftsführerin, was etwas sehr Besonderes für mich ist. Weil es eben nicht nur um Zahlen geht.
Sondern um etwas Sinnstiftendes?
Ich möchte nicht behaupten, dass in der Finanzindustrie zu arbeiten nicht auch sinnstiftend sein kann. Es erfüllt mich aber sehr, dass ich bei Pro Pallium all die Dinge, die ich in der Bankenwelt gelernt habe, anwenden kann, um dem Team den Rücken freizuhalten. Nur so kann das Team diesen wertvollen Job machen.
Und wie viel verdienst du dabei?
Mit einem 80-Prozent-Pensum erhalte ich knapp über 100’000 Franken pro Jahr.
Pro Pallium ist rein über Spenden finanziert. Reicht das?
Ja, das reicht. Die Spendenbereitschaft ist aktuell aber sehr gering.
Woran liegt das?
In den letzten Jahren sind sehr viele NGOs entstanden. Die Anzahl der Spender und Förderstiftungen blieb jedoch unverändert. Wir konnten in den letzten Jahren aber zum Glück ein gewisses finanzielles Polster ansparen. Spender:innen hinterfragen manchmal, warum ein Teil ihres Geldes nicht immer sofort in Familien investiert wird. Das liegt daran, dass wir in guten Jahren natürlich nicht nur kostendeckend sein wollen, sondern auch einen Überschuss aufbauen müssen, um genau eine Phase wie die jetzige abfedern zu können.
Und bist du auch Spenderin bei Pro Pallium?
Ja. Es war am Anfang komisch, weil ich mein Gehalt von Pro Pallium bekomme. Allerdings spende ich sowieso jedes Jahr – und das hat nicht nur steuerliche Gründe. (Lacht.) Ich freue mich, wenn ich etwas zurückgeben kann.
Nach welchem Grundsatz spendest du?
Ich habe schon immer gespendet. Wenn’s bei mir finanziell etwas enger war, waren es kleinere Beträge.
Was heisst das konkret?
Rund 1000 bis 2000 Franken im Jahr. Hier habe ich kein genaues Budget, sondern spende, wenn mein Herz berührt wird. Ich unterstütze gerne kleinere Organisationen. Tier-, Kindes-, Menschenwohl. Gerne Regionales, weil ich bei meiner Arbeit gemerkt habe, wie viel vor unserer Haustür ein Augenmerk braucht. Was die Versorgungsgerechtigkeit anbelangt, sollte die Politik aber unbedingt genauer hinsehen.
Was meinst du damit?
Laut Verfassung müssen alle den gleichen Zugang zum Versorgungsnetzwerk haben. Bei unseren Familien merken wir, dass es eben nicht so ist. Unser Gesundheitssystem ist darauf ausgelegt, zu heilen. 10’000 Kinder in der Schweiz sind aber von einer unheilbaren Krankheit betroffen. Entweder leidet ein solches Kind an einer Krankheit, die schon eine gewisse Lobby hat – Krebs zum Beispiel. Oder es leidet an einer seltenen Krankheit, wo es keine etablierten Institutionen gibt. Und dann wohnt es vielleicht in einer kleineren Gemeinde und wird von einer Pädiaterin oder einem Pädiater behandelt, die oder der zum ersten Mal ein nicht heilbares Kind vor sich sitzen hat und schlichtweg zu wenig Erfahrung im Umgang mit solchen Fällen mitbringt.
Was bedeutet das für die Eltern finanziell?
Die Eltern, die ihr Pensum reduzieren, sind dreifach bestraft: Sie haben weniger Lohn und können weniger in die Vorsorge einzahlen. Als Folge sehen sie sich mit Altersarmut konfrontiert. 30 Prozent der Mütter mit einem erkrankten Kind arbeiten gar nicht, was doppelt so viele sind wie bei den Müttern mit gesunden Kindern. Die Anträge für eine finanzielle Unterstützung vom Staat sind für die Familien zeit- und kostenintensiv. Das ist ein Kampf, den Eltern mit einem todkranken Kind nicht austragen sollen müssten.
Wie sind deine Eltern mit Geld umgegangen? Welches Verhältnis zu Geld wurde dir als Kind beigebracht?
Geld gibt mir Sicherheit. Das liegt daran, dass während meinen ersten zehn Lebensjahren immer viel zu wenig davon da war. Ich erinnere mich: Meine Mutter sass damals am Küchentisch und hat Münzen gezählt. Darum wünsche ich mir nun Sicherheit. Sicherheit für jetzt, fürs Alter, für meine Familie und für mich.
Wenn du an die Zeit zurückdenkst: Was würdest du deinem damaligen Ich für einen Finanztipp mit auf den Weg geben?
Dass es gut kommt, solange immer schön 20 Prozent des Gehalts auf das Sparkonto fliessen (lacht).
Und dieses Geld investierst du dann?
Ja.
Was ist deine Strategie?
Ich investiere hauptsächlich in ETFs: in weltweite, in Schweizer und zur Absicherung auch in Gold-ETFs. Da ich nicht so viel Zeit zum Traden habe, fokussiere ich mich ganz auf ETFs.
Bei deiner Arbeit dreht sich alles um einen guten Zweck. Kann man das auch über dein Portfolio sagen?
Es gibt Branchen, die für mich ein No-Go sind. Die Rüstungsindustrie zum Beispiel. Aber bezüglich Nachhaltigkeit könnte ich sicherlich bewusster investieren. Ich könnte nicht einmal Annahmen treffen, welche Trends mein Portfolio begünstigt. Auf Herz und Nieren teste ich es dann auch wieder nicht.
Zu guter Letzt: Welchen Preis hat Lebensqualität?
Lebensqualität und Würde sind unbezahlbar. Einerseits sollten sie selbstverständlich sein, also kostenlos. Weil jeder Mensch sie verdient hat. Auf der anderen Seite hat Lebensqualität einen so unermesslichen Wert, dass man sie gar nicht mit genug Nullen beziffern kann.

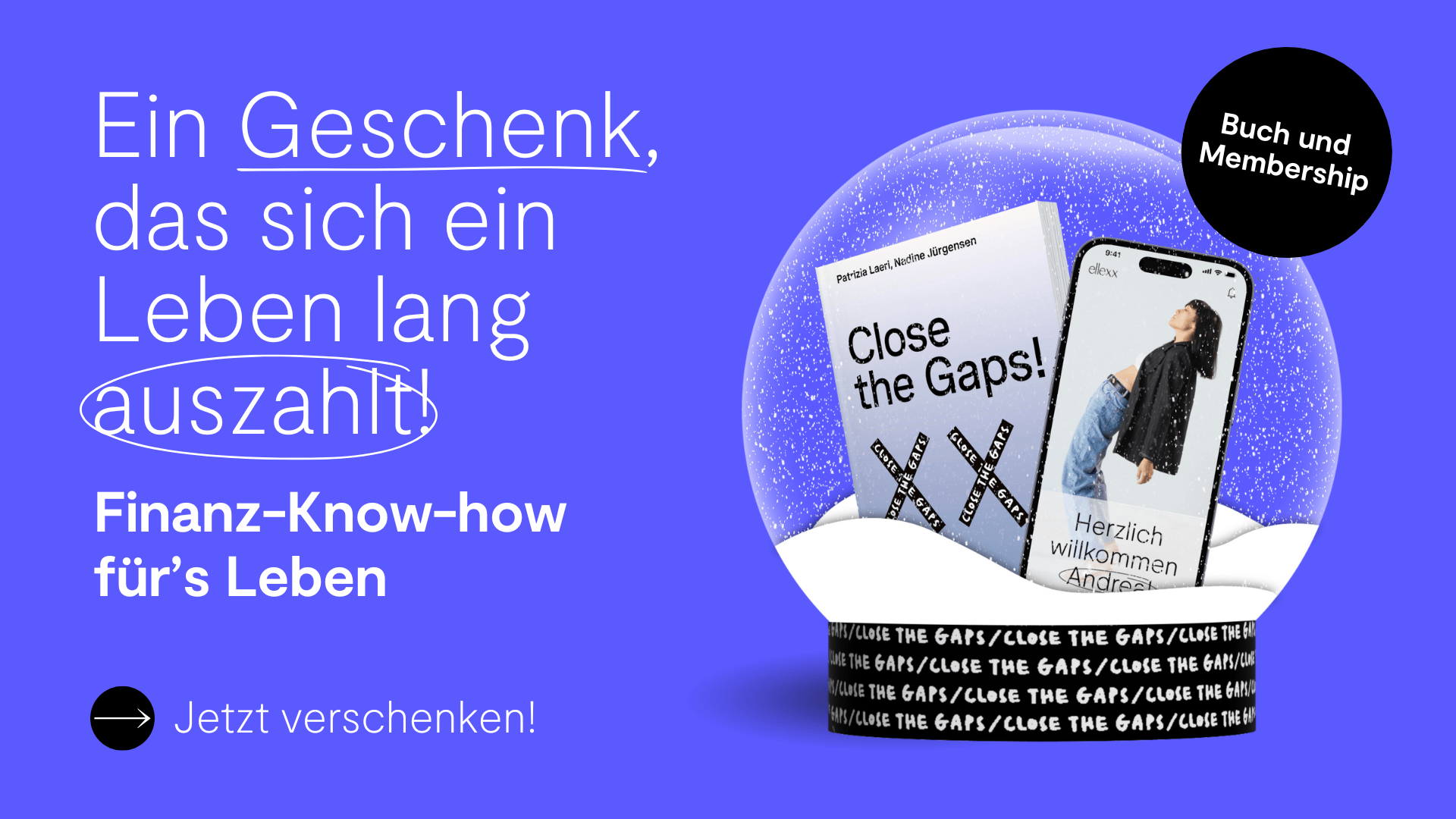
.png-.jpg)






