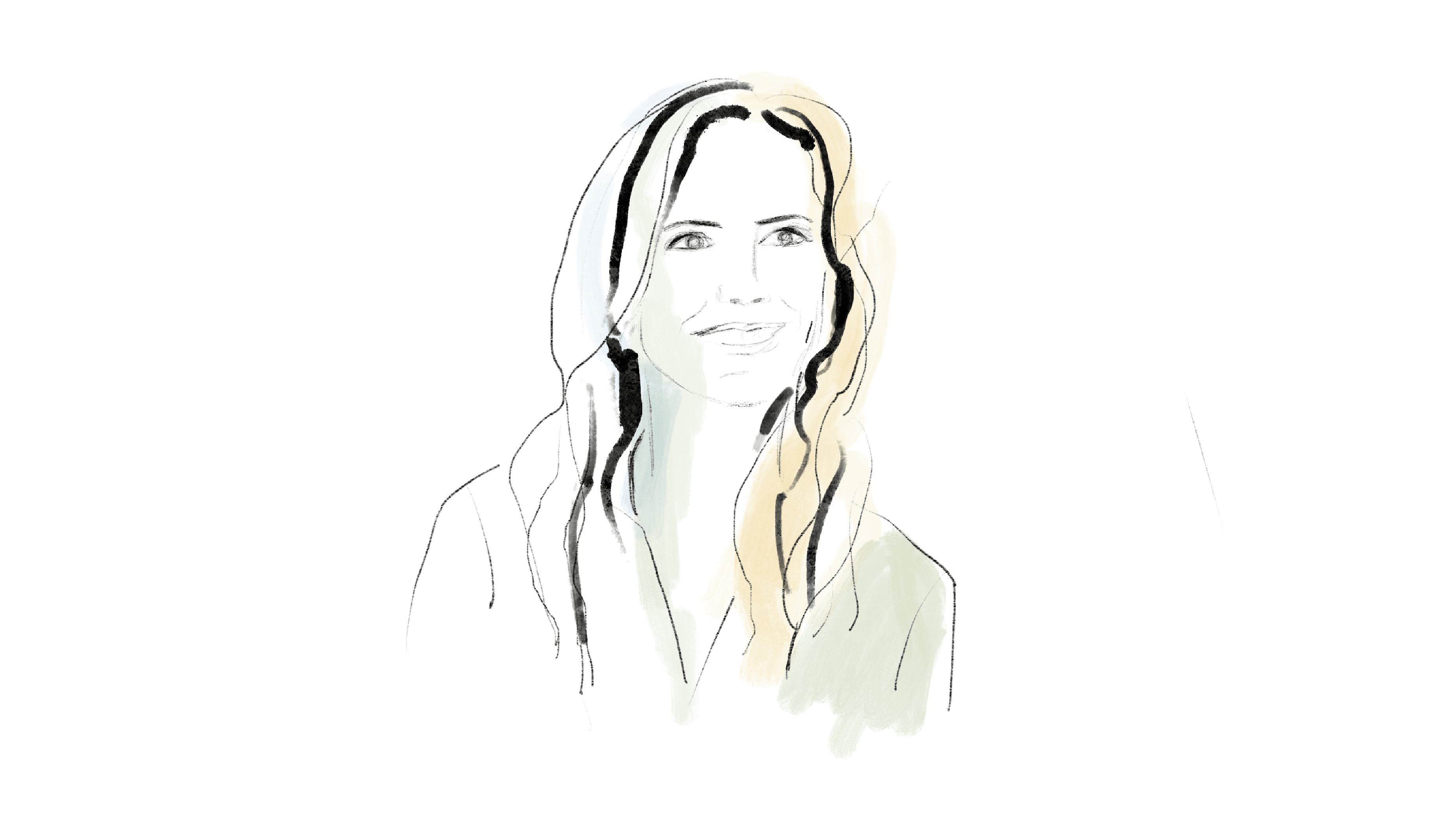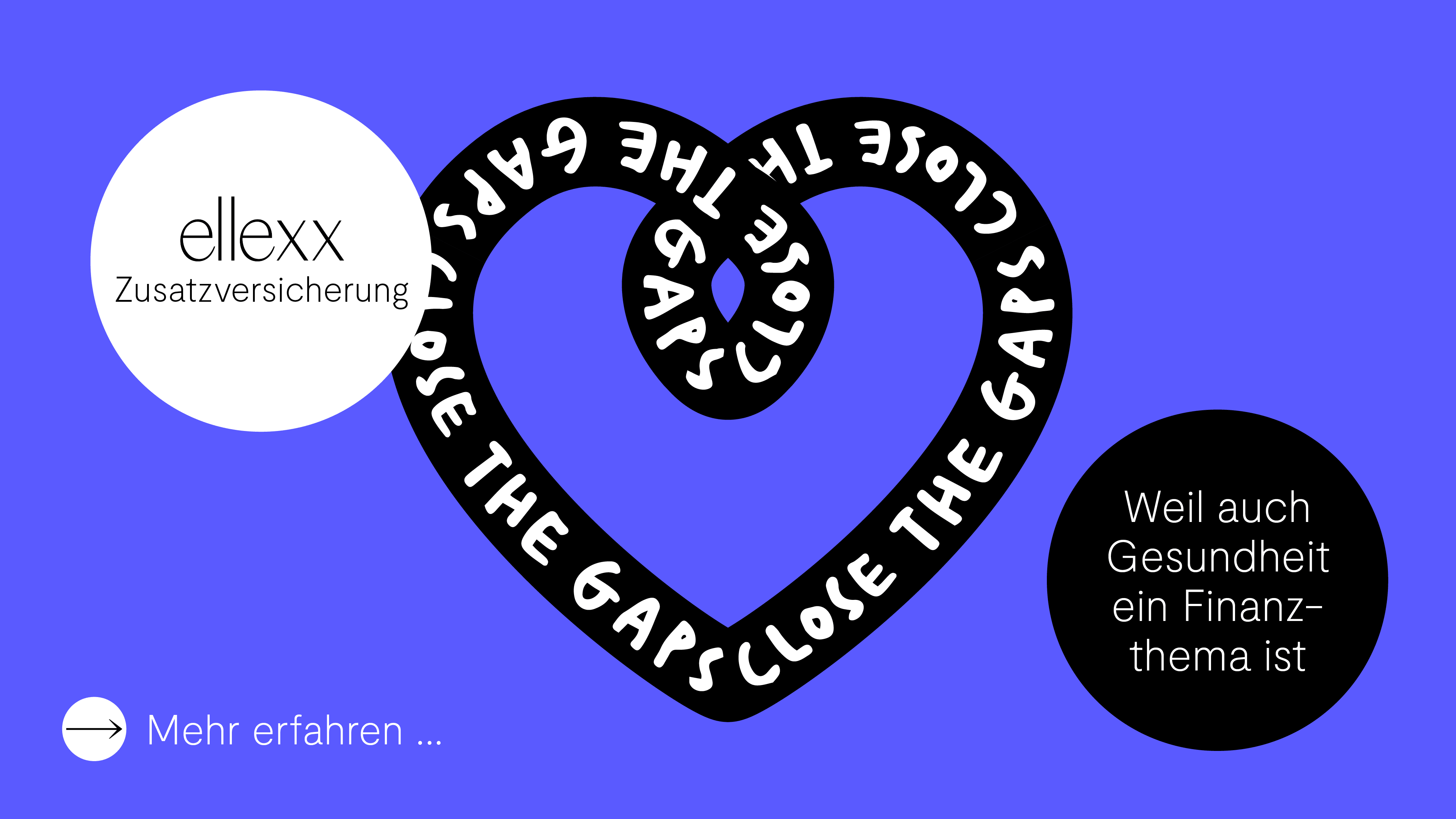In der dritten Folge des ellexx Podcast «health talXX» geht es um Geburtstrauma. Das kann Menschen, die Ähnliches erlebt und es noch nicht verarbeitet haben, triggern. Wir empfehlen dir in diesem Fall, den Podcast besser nicht zu hören.
Ein Grossteil der Schweizer Kinder erblickt im Spital das Licht der Welt, genau genommen hohe 95 Prozent. Es ist also ein verschwindend kleiner Teil der Frauen, die sich für eine Geburt zu Hause oder im Geburtshaus entscheidet.
Not-OPs, Hilflosigkeit, Angst
Geburten ohne Interventionen bringen den Spitälern und Ärzten weniger Geld. Das ist mit ein Grund, warum die Kaiserschnittrate in gewissen Spitälern extrem hoch ist. Laut WHO gelten 15 Prozent Kaiserschnittgeburten als normal, in der Schweiz sind es im Schnitt 33 Prozent, und in gewissen Krankenhäusern ist es fast jede zweite Frau, die einen erhält – teils mit traumatisierenden Folgen.
Fabienne Meyenhofer, die eine gute und gesunde Schwangerschaft erlebt hat, erzählt im Podcast, wie sich dies plötzlich alles geändert hat. Eines Tages war sie wie gelähmt – später im Spital wurde festgestellt, dass sich der Mutterkuchen gelöst hatte und das Herz des Babys nur noch schwach schlug. Ein medizinischer Notfall, ein Horrorszenario für jede schwangere Frau.
Meyenhofer erzählt: «Der Notfall-Kaiserschnitt, die ganze OP war enorm traumatisierend. Ich habe dieses Geräusch des Schnittes, wenn die Haut aufgerissen wird, heute noch in den Ohren. Und beim Vernähen haben sie über die Skiferien gesprochen.»
Fehlende oder missbräuchliche Kommunikation
In Studien konnte man nachweisen, dass es in der Geburtshilfe immer wieder zu schmerzhaften und unnötigen Interventionen kommt. Damit sind alle Eingriffe in den natürlichen Geburtsverlauf gemeint. Das kann die schmerzhafte Abtastung des Muttermundes sein oder die Öffnung der Fruchtblase ohne Einverständnis. Es können aber auch intensivere Eingriffe sein wie eine Geburtseinleitung, Betäubung mit starken Medikamenten, Wehentröpfe, Dammschnitt oder Periduralanästhesie (PDA), eine rückenmarksnahe Narkose. Diese Eingriffe können natürlich sinnvoll und wichtig sein. In der Praxis sind diese Eingriffe aber oft nicht abgesprochen und werden teilweise ohne Einverständnis der Gebärenden unternommen. Oft geht es um fehlende oder missbräuchliche Kommunikation: Es werden Informationen nicht mitgeteilt, oder Fachpersonen klären ungenügend über Vor- und Nachteile auf.
Eine Umfrage bei über 6000 Frauen der Berner Fachhochschule zeigte erschreckende Resultate: Ungefähr die Hälfte der Frauen hatte zu wenig Zeit, sich für oder gegen eine Intervention zu entscheiden, 41 Prozent erhielten diesbezüglich zu wenig Informationen, sprich wurden zu wenig aufgeklärt. Besonders stossend: Jede vierte Frau fühlte sich eingeschüchtert, und bei jeder zehnten wurden Interventionen vollzogen, auch wenn sie sich dagegen gewehrt hatte.
Traumatische Erlebnisse mit langfristigen Folgen
Diese traumatischen Erlebnisse können in der Zeit nach der Geburt kaum verarbeitet werden und langfristige und schwere Folgen für die Mütter haben. «Ich war nach der Geburt total überfordert und alleine. Ich habe ständig innerlich geweint. Erst drei Monate nach der Geburt hatte ich dann mal eine Stillberatung», berichtet Meyenhofer.
Danach erhielt sie die Diagnose: posttraumatische Belastungsstörung. Die junge Mutter hatte noch nie davon gehört. Tatsächlich entwickeln etwa zehn Prozent der jungen Mütter in den ersten Wochen nach der Geburt eine Anpassungsstörung und drei Prozent schliesslich eine Belastungsstörung wie Fabienne.
Insbesondere Frauen mit schweren Geburtsverletzungen, heftigen Blutungen oder jene, die nahe einer Sterbeerfahrung gewesen sind oder komplette Hilflosigkeit, Ausgeliefertsein und Kontrollverlust erlebt haben, sind besonders gefährdet. Diese Erfahrungen können die Beziehung zu einem Kind ein Leben lang stören, wenn sie nicht therapiert werden.
Engere Betreuung der Mütter
Die mittlerweile zweifache Mutter Meyenhofer wünscht sich ein anderes Gesundheitssystem. Sie will vor allem, dass sich eines ändert: «Wenn ich nochmals gebären könnte, dann würde ich das heute nur noch mit einer Geburtsbegleiterin, einer Doula, tun. Diese können auch eine Brücke zwischen Frau und Mann bilden und wichtige Übersetzerinnen in allen Belangen sein.»
Diese nicht-medizinischen Begleiterinnen agieren als eine Art Anwältinnen der Gebärenden und stehen für deren Wünsche und Bedürfnisse ein – auch wenn das Fachpersonal Druck ausüben sollte. Studien zeigen, dass diese Art von Begleitung den Verlauf einer Geburt positiv beeinflussen kann. Mütter, welche eine Doula hatten, hatten sogar nur halb so viele Geburtskomplikationen.
Doch die meisten Zusatzversicherungen übernehmen die Kosten dieser Geburtsbegleiterinnen nicht. Gerade Frauen, die allgemein versichert sind, können sich ihre Ärzt:in nicht aussuchen. Genau dann ist es umso wichtiger, eine Vertrauensperson dabei zu haben. Eine 1:1-Betreuung, also eine Person, die nur für Gebärende da ist, gibt es in keinem Spital garantiert.
Entscheidend ist es, dass Schwangere sich schon im Vorfeld über Interventionen informieren, dass sie während der Geburt auch über jeden Schritt aufgeklärt werden und dass ihr Einverständnis eingeholt wird. Genau das hat bei den meisten Frauen zu einer Traumatisierung geführt: Ihre Bedürfnisse und Wünsche wurden nicht gehört.