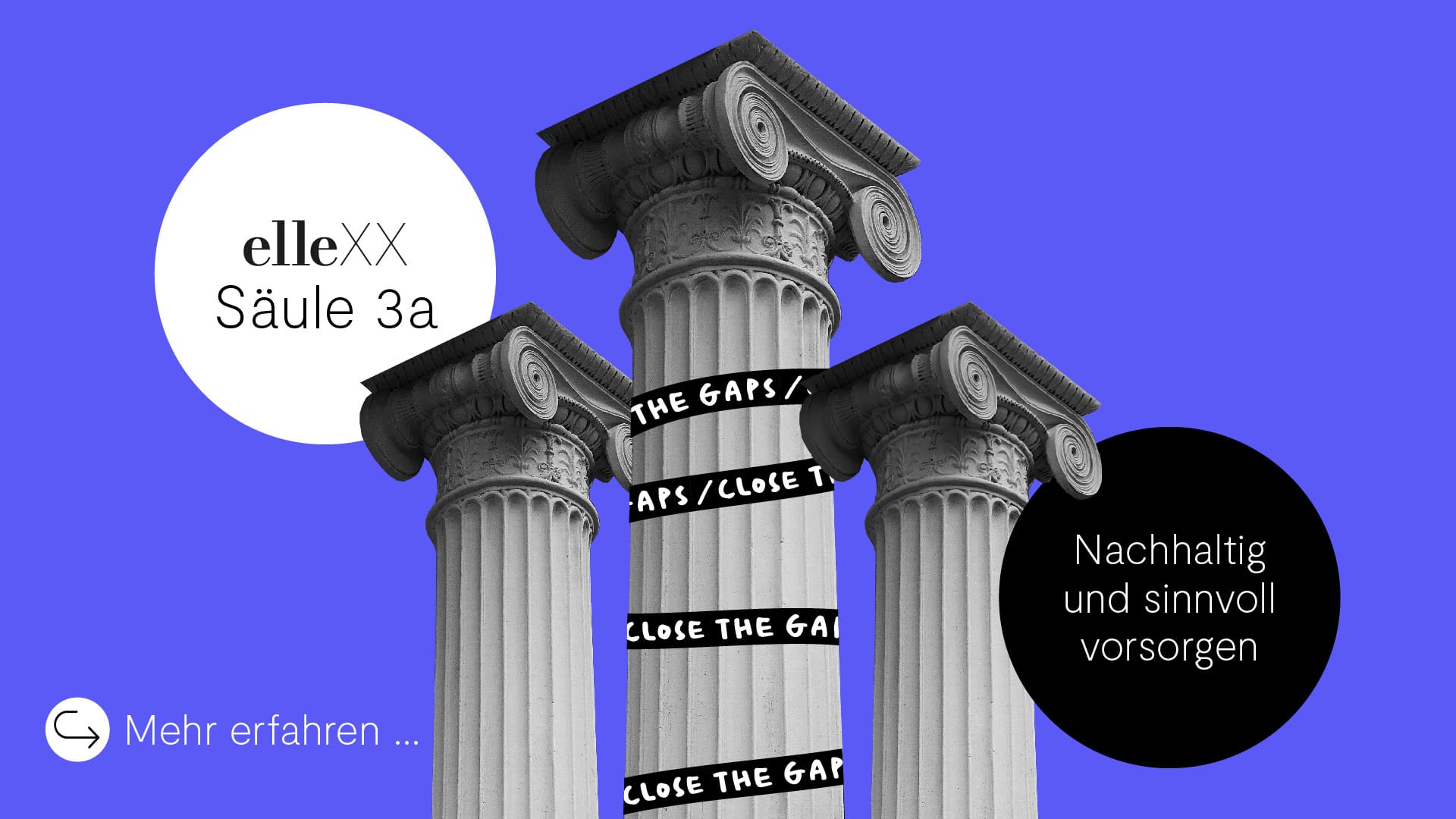Besonders Junge und Frauen fehlen heute häufiger als früher am Arbeitsplatz, berichtete die Sonntagszeitung Anfang August: Die Ausfälle am Arbeitsplatz sind im Vergleich zu 2022 um 20 Prozent angestiegen, im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor Pandemiebeginn, sogar um 34 Prozent. Grund dafür sind unter anderem ein stärkeres Gesundheitsbewusstsein als vor der Pandemie und eine vermehrte psychische Belastung durch Stress bei der Arbeit.
Nun lässt sich natürlich, wie es sich für eine leistungsorientierte Gesellschaft gehört, ausrechnen, wie teuer diese Ausfälle Arbeitgeber:innen zu stehen kommen: Das Absenzmanagement rechnet mit Kosten von 600 bis 1000 Franken pro Tag, wenn jemand nicht zur Arbeit erscheint. Rund 22 Milliarden Franken haben Krankmeldungen Versicherungen und Unternehmen im letzten Jahr insgesamt gekostet.
In der Schweizer Arbeitswelt gibt es zwar immer mehr Sensibilisierung und entsprechende Massnahmen. Anti-Stress-Workshops, Teilzeit (immer öfter sogar für Väter!) und Gleitzeit sind viel verbreiteter als noch vor einem Jahrzehnt. Das scheint aber noch nicht auszureichen. Eine aktuelle Studie der CSS zeigt: Für rund 60 Prozent der 18- bis 40-Jährigen stellt der Beruf ein ungesundes Stressrisiko dar. Und die 42-Stunden-Woche bedeutet für viele nicht nur Stress pur, sie ist auch ein grosser Bremsklotz für die Vereinbarkeit.
Dass man diese Zeilen überhaupt schreiben muss, verursacht bei mir Hühnerhaut, liebe Leser:innen, aber nicht im guten Sinne. Ich persönlich würde gerne in einer Welt leben, in der Arbeitnehmer:innen in erster Linie als Menschen gesehen werden – und nicht als Kostenfaktor in der Erfolgsrechnung Ende Jahr.
Dass Menschen daheim bleiben, wenn sie krank sind, ist als gutes Zeichen zu werten. Dass satte 44 Prozent der 18- bis 35-Jährigen schon einmal der Arbeit ferngeblieben sind, weil es ihnen psychisch nicht gut ging, als sehr schlechtes Zeichen. Wer das als «Krankfeiern» bezeichnet, litt wohl noch nie unter Depressionen.
Und hier müsste man ansetzen. Es braucht keine strengeren Gesetze zugunsten der Arbeitgeber:innen, wie beispielsweise aus bürgerlichen Kreisen gefordert wird, es braucht im Gegenteil mehr Fürsorge für die Angestellten. Langfristige Krankmeldungen verursachen übrigens höhere Kosten für Betriebe. Auch aus wirtschaftlicher Sicht würde es sich also lohnen, den Angestellten ein gesundes Umfeld zu bieten: Wer zufrieden ist, wird weniger krank, kommt gerne zur Arbeit und erledigt seine Aufgaben effizienter und besser, das beweisen Studien immer wieder.
Wie es auch ginge, zeigt ein Blick über die Landesgrenze hinaus: Skandinavische Länder beispielsweise setzen auf flexible Arbeitszeitgestaltung, Teilzeit ist oft problemlos möglich, die wöchentliche Arbeitszeit ist auf 40 Stunden begrenzt. In Frankreich gilt gar die 35-Stunden-Woche, und Arbeitnehmende werden per Gesetz davor geschützt, nach Feierabend für die Firma erreichbar sein zu müssen. Halten sich Chef:innen nicht daran, können sie gebüsst werden. Und das scheint sich auszuzahlen: In der OECD-Studie «How’s Life?» belegt Frankreich den zweiten Platz in der Kategorie «Work Life Balance».Die Schweiz ist übrigens auf Platz 18.
Wir leben in einer Zeit der wirtschaftlichen Unsicherheit, einer ganzen Generation wurde durch die Pandemie ein Teil der 20er geraubt, und immer mehr Menschen merken, dass ihr Job sie nicht erfüllt – und mehr noch, dass ihnen eine solche Erfüllung durch Lohnarbeit vielleicht gar nicht so wichtig ist. Phänomene wie «quiet quitting» und «lazy girl jobs» – also Dienst nach Vorschrift und kein bisschen mehr oder Arbeiten, die ohne viel Aufwand für vergleichsweise viel Geld erledigt werden – trenden auf Tiktok seit Monaten.
Das sagt viel darüber aus, wie sich die gesellschaftliche Einstellung gegenüber der Erwerbsarbeit verändert. Und es zeigt auch: Mehr und mehr stellen die Menschen ihr Privatleben und vor allem ihre Gesundheit über ihren Job. Und gerade in Zeiten von Fachkräftemangel gilt: Unternehmen sollten nicht nur besser auf ihre Angestellten achten – sie müssen, wenn sie sie nicht verlieren wollen.