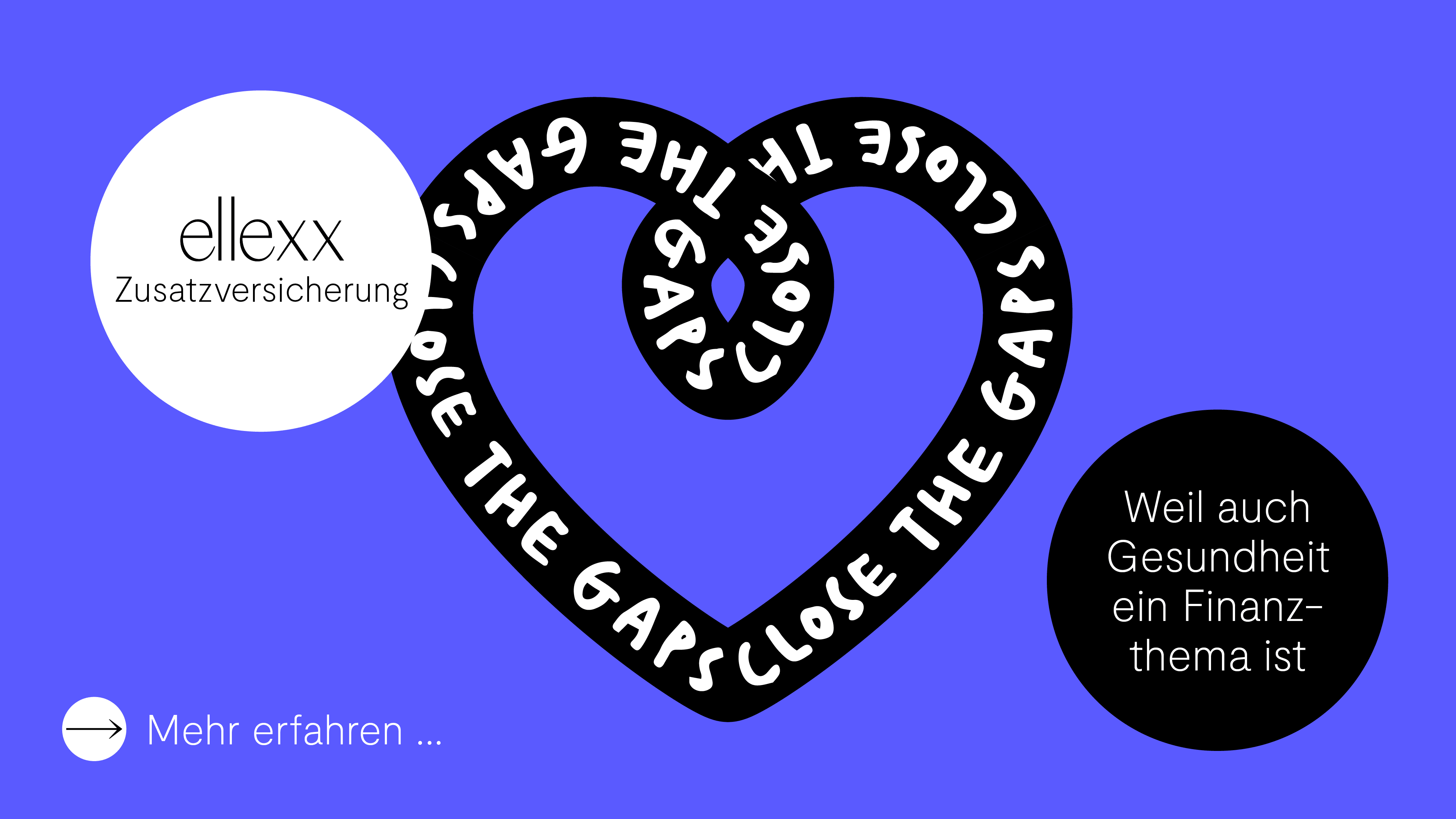Krebs betrifft Frauen und Männer auf unterschiedliche Weise. Doch diese Unterschiede spiegeln sich nicht immer in der Forschung und Behandlung der Krankheit. In einem Bericht des Wissenschaftsmagazins «The Lancet» wird darum ein Gender-Fokus gefordert. Die Verfasser:innen, eine internationale Expert:innen-Kommission, verlangen eine Krebsmedizin, die das Geschlecht berücksichtigt. Denn Frauen seien bereits in der Erforschung der Krankheit, aber auch in der Diagnose und Behandlung sowie in der Prävention diskriminiert.
Die Studienautor:innen stellen fest, dass Frauen – unabhängig von sozialer und geografischer Herkunft – nicht denselben Zugang zu Informationen und damit letztlich zu Therapiemöglichkeiten haben wie Männer. Auch in reichen Ländern sei dies ein Problem.
2,3 Millionen Frauen unter 70 Jahren sterben jährlich an Krebs
Jedes Jahr sterben weltweit rund zehn Millionen Menschen an Krebs. Darunter sind 2,3 Millionen vorzeitige Todesfälle bei Frauen unter 70 Jahren. Durch Primärprävention oder Früherkennung könnten jedoch 1,5 Millionen Frauen gerettet werden. Weitere 800’000 Sterbefälle liessen sich durch bestmögliche Krebsbehandlung vermeiden.
Krebs ist die häufigste Ursache für vorzeitige Sterblichkeit vor dem 70. Lebensjahr und die zweithäufigste Todesursache in der Schweiz. Laut Bundesamt für Statistik ist er bei Frauen zwischen 25 und 84 Jahren und bei Männern zwischen 45 und 84 Jahren sogar die häufigste Todesursache. In der Schweiz starben im Jahr 2020 9200 Männer und 7700 Frauen daran.
Wie viel Geld in die Krebsforschung investiert wird, lässt sich nicht genau beziffern. Die Stiftung Krebsforschung steckt gemeinsam mit ihrer Partnerorganisation Krebsliga Schweiz jährlich rund 20 Millionen Franken in die unabhängige Krebsforschung. Hinzu kommen die Investitionen von Schweizer Pharmafirmen, die Höhe ist allerdings nicht bekannt. Weltweit flossen zwischen 2016 und 2020 24,5 Milliarden US-Dollar an öffentlichen Mitteln und Spendengeldern in die Krebsforschung, ohne Investitionen von Pharmafirmen.
Das Patriarchat dominiert die Krebsbehandlung
Die Studie von «The Lancet», basierend auf Daten aus 185 Ländern, zeigt, dass Frauen innerhalb des Personals in der Krebsmedizin unterrepräsentiert sind, insbesondere in Führungspositionen. Gemäss der Union for International Cancer Control (UICC), einer Vereinigung mit Sitz in Genf, die sich weltweit für die Krebsprävention sowie für Betroffene der Krankheit einsetzt, würden nur 16 Prozent der 200 Mitgliederorganisationen von Frauen geführt, dazu zählen Spitäler und Forschungseinrichtungen aus aller Welt. Ein weiteres Beispiel: Nur 20 der 100 führenden Wissenschaftspublikationen hätten Chefredaktorinnen. Die Liste liesse sich weiterführen: Seit 1901 haben mehr als 200 Personen den Medizin-Nobelpreis erhalten, darunter nur zwölf Frauen.
Gleichzeitig sind es aber Frauen, die sich mehrheitlich um die Pflege von Krebspatient:innen in der Familie kümmern – unbezahlt. So schreiben die Studienautor:innen, das «Patriarchat dominiert die Krebsbehandlung und -forschung sowie die Gesundheitspolitik. Jene in Machtpositionen entscheiden, was Priorität hat, was finanziert und erforscht wird.»
Fehlendes Wissen hat fatale Folgen
Wie äussert sich dieses Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern? Frauen fehlt in einigen Ländern häufig schlicht das Wissen über Krebs, um informierte Entscheidungen über ihre Behandlung treffen zu können. Oftmals gehen sie erst in einem fortgeschrittenen Krebsstadium zum Arzt. Dies passiere laut den Studienautor:innen nicht nur in ärmeren, sondern auch in wirtschaftlich entwickelten Ländern. Allerdings liegt die vorzeitige Sterblichkeit von Frauen in den sogenannten reichen Staaten bei 36 Prozent, während in Ländern, die auf dem Index der menschlichen Entwicklung (Human Development Index, HDI) niedrig eingestuft werden, 72 Prozent der an Krebs erkrankten Frauen vor dem 70. Lebensjahr sterben.
Ein feministischer Ansatz von der Datenerhebung bis zur Behandlung
Die Lancet-Kommission «Frauen, Macht und Krebs» fordert unter anderem, dass in Krebsstatistiken gezielt Daten zu Geschlecht und anderen soziodemografischen Faktoren einbezogen werden sowie einen «feministischen Ansatz» in der Krebsbehandlung, um Ungleichheiten aufgrund des Geschlechts zu beseitigen. Dieser beginnt bei der Datenerhebung und den Erkenntnissen über Krebserkrankungen bei Frauen und setzt sich fort in einer stärkeren Einbeziehung von Frauen in Wissenschaft, Forschung und Führungspositionen sowie in mehr klinischen Studien, die auf die besonderen Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten sind.
Geschlechtsspezifische Unterschiede werden heute noch zu wenig berücksichtigt in der Medizin, kritisieren Gesundheitsexpert:innen. Auch in anderen Bereichen der medizinischen Forschung und Lehre ist der «Durchschnittsmensch» in der Regel immer noch männlich. Frauen waren beispielsweise lange Zeit von Studien zur Erprobung neuer Medikamente ausgeschlossen.
Die Gendermedizin will das ändern und so die Gesundheitsversorgung für alle Menschen verbessern. Das Thema kommt auch in der Schweiz in Bewegung. Die Universität Zürich startet in Kürze den ersten Gendermedizin-Lehrstuhl des Landes, um Frauen in der Medizinforschung und geschlechtsspezifische Unterschiede in den Blick zu nehmen. Der Bund lancierte im Juni 2023 ein nationales Forschungsprogramm «Gendermedizin und Gesundheit» über 11 Millionen Franken.
.png)