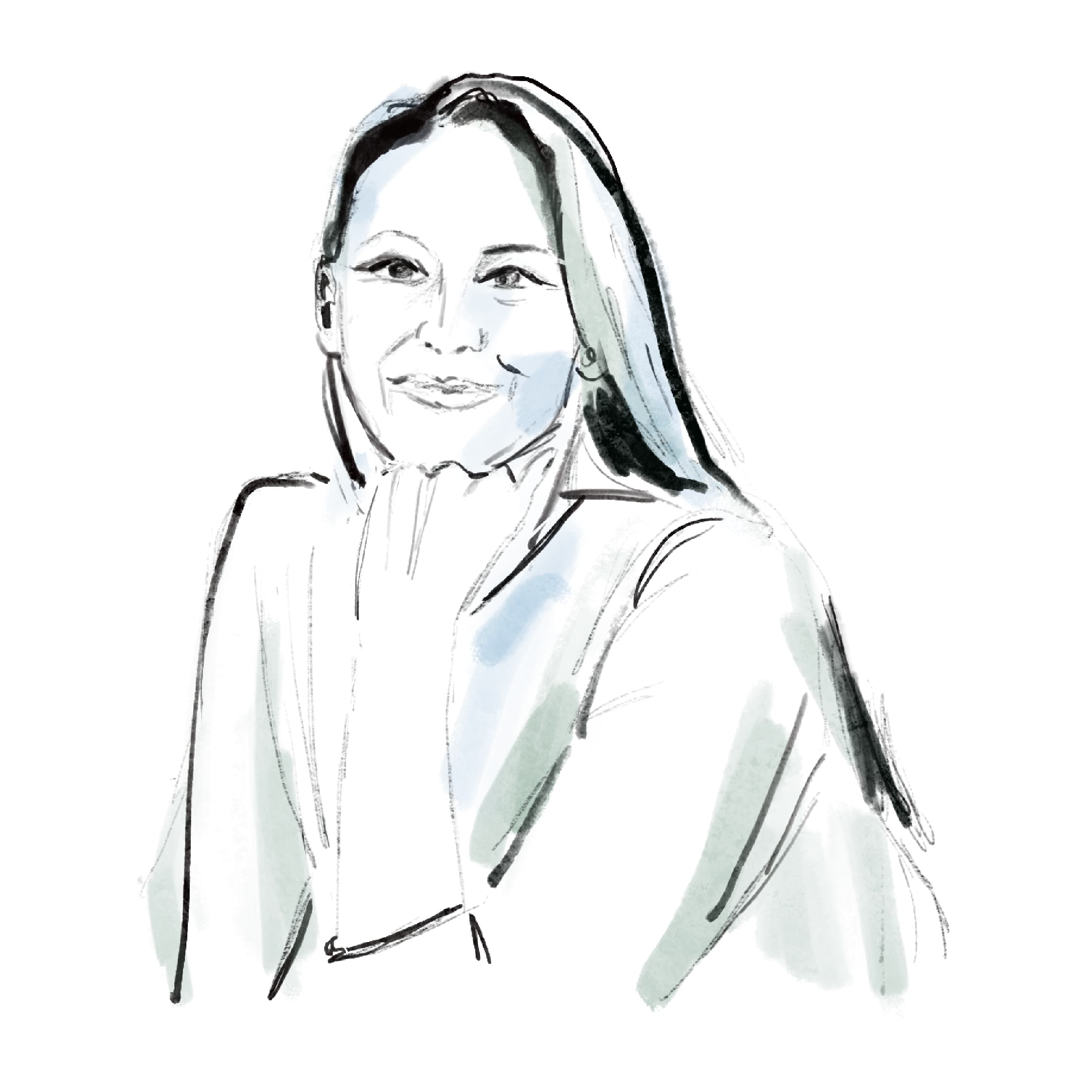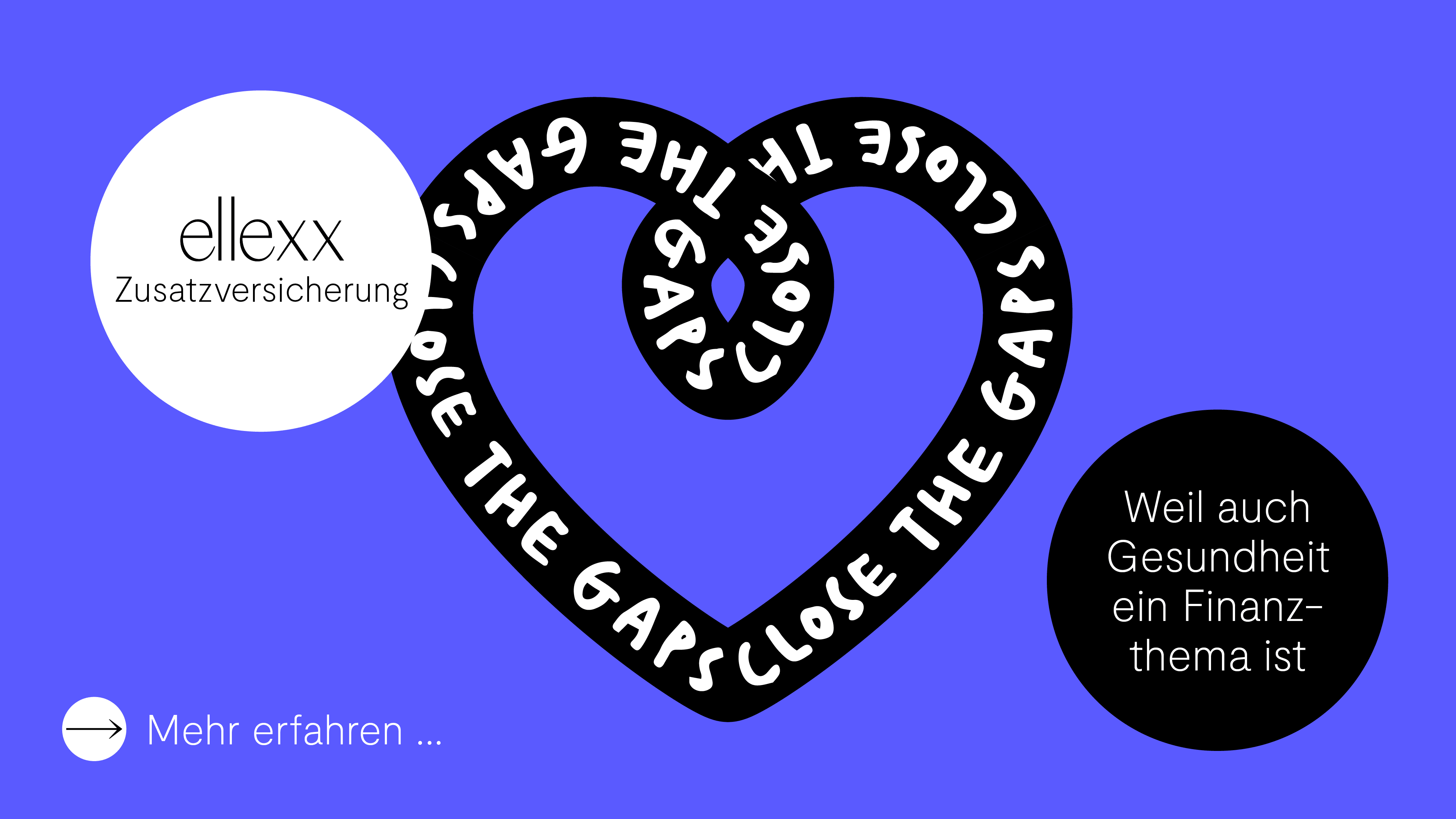Vielleicht habt ihr es auch gesehen: Kürzlich veröffentlichte die SRG die Ergebnisse der Meinungsumfrage «Wie geht’s, Schweiz?». Über 57’000 Personen haben im Frühling dieses Jahres daran teilgenommen. Nach eigenen Angaben war es eine der grössten repräsentativen Umfragen, die es hierzulande je gegeben hat. Bei der Publikation titelte SRF: «Stress am Arbeitsplatz. Hunderttausende in der Schweiz Burnout-gefährdet.»
Und wow, die publizierten Zahlen sind echt erschreckend: 17 Prozent aller Einwohner:innen gaben an, aufgrund des Arbeitsplatzes bereits ein Burnout erlebt zu haben. Weitere 25 Prozent stufen sich selbst als gefährdet ein, darunter zum grössten Teil Frauen zwischen 16 und 39 Jahren. Auch wenn es nicht explizit abgefragt wurde, liefern die Kollegen:innen des SRF bereits einen Grund dafür mit: Junge Frauen seien rund um die Familiengründung stark belastet, das mache sie anfälliger, schreiben sie.
Ich persönlich bin beim Lesen der Ergebnisse mehrmals hängen geblieben. Zuerst an der Formulierung «aufgrund des Arbeitsplatzes». Als Betroffene, die sich auf LinkedIn als Burnout Survivor geoutet hat, kam ich mit Hunderten Frauen und auch ein paar Männern in Kontakt, die mir ihre Geschichten erzählt haben. Kein:e einzige:r von ihnen ist ausschliesslich wegen der Belastung im Job ausgebrannt. Immer war es eine Kombination aus verschiedenen Faktoren (z.B. zu hohe Arbeitsbelastung + Mobbing + Elternschaft).
Leider hat die WHO 2019 beschlossen, dass Burnout offiziell nur noch mit «chronischem Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet wird», diagnostiziert werden darf. Zuvor gab es gar keine offizielle Diagnose, weil man sich innerhalb der Weltgesundheitsorganisation nicht einig werden konnte, ob Burnout überhaupt eine Krankheit ist!
Ich finde, die Definition klingt, als könnte man uns wie Maschinen in Einzelteile zerlegen. Ein Teil fürs Berufs-, ein weiteres fürs Privatleben. Absurd, oder? Und doch so bezeichnend, denn genau unter dieser weltfremden Unterteilung leiden Menschen, die sowohl care- als auch lohnarbeiten, jeden Tag. Die Logik unserer Arbeitswelt zwingt uns dazu, uns vor allem als «Professionals» zu präsentieren und Privates möglichst aussen vor zu lassen.
Ich selbst habe nach der Geburt unserer Tochter versucht, mir im Arbeitsalltag quasi nicht anmerken zu lassen, dass ich Mutter geworden bin. Zu gross war die Sorge, meine hart erarbeitete Karriere würde den Bach runtergehen, weil ich als nicht mehr so belastbar und leistungsfähig wie vorher wahrgenommen werden würde. Also strampelte und strampelte ich, stockte relativ schnell von 60 auf 80, irgendwann wieder auf 100 Prozent auf, in der Hoffnung, mein Arbeitsvolumen so besser stemmen zu können und ja nicht auf dem Abstellgleis zu landen. Nur leider funktioniert dieses Konzept nicht. Denn niemand klopft dir auf die Schulter, wenn du ein Projekt (oder besser noch 2, 3, 4, 5 gleichzeitig) erfolgreich abgeschlossen hast, und bedankt sich damit, dass du ab sofort weniger arbeiten musst. Im Gegenteil. Wer performt, bekommt ständig neue Aufgaben auf den Tisch gelegt. Bei mir hat das dazu geführt, dass erst meine eigenen Bedürfnisse, dann die meiner Freund:innen und letztlich auch noch die meiner Familie unter den Tisch fielen. Bis mir das Burnout den Boden unter den Füssen wegriss. Erst während meines Heilungsprozess wurde mir klar, dass es unmenschlich war, was von mir erwartet wurde. Und dass ich einfach funktionierte, weil ich dachte, es müsse so sein, bis … ja, bis ich eben nicht mehr funktionierte.
Was mich zu der zweiten Stelle bringt, an der ich beim Lesen der Studie stolperte: «Junge Frauen sind rund um die Familiengründung sowieso stark belastet, das macht sie anfälliger». Meines Wissens gehören zur Familiengründung in der Regel immer noch zwei. Wieso also sind wir Frauen «anfälliger»?
Mein Fazit nach monatelanger Reflektion: Weil wir in einer Übergangsphase leben, in der wir von Politik, Wirtschaft und sogar von unserem privaten Umfeld im Stich gelassen werden. Die zweite Welle der Frauenbewegung hat uns zwar die zuvor verschlossenen Türen zur Lohnarbeit geöffnet, die nötigen Rahmenbedingungen und der allgemeine Mindset haben sich aber nicht im gleichen Tempo angepasst, wie Frauen in den Arbeitsmarkt drängten. Mit dem Resultat, dass wir heute zwei Schichten machen, im Geschäft und daheim, wenn wir uns dazu entscheiden, Kinder zu haben und lohnarbeiten zu wollen.
In welch einen Teufelskreis wir dabei geraten, hat Karen Schärer in einem Artikel für den Blick, in dem sie auch auf meine Geschichte verwies, am vergangenen Wochenende wunderbar auf den Punkt gebracht:
«Eine Mutter, die Teilzeit arbeitet, muss beständig gegen das latente Vorurteil ankämpfen, ihr Hauptfokus liege bei der Familie, die Arbeit sei für sie nur Abwechslung oder Hobby. Die Folge davon: Sie kniet sich noch stärker rein, leistet proportional mehr, bevor sie abgehetzt zum Kind eilt, womit ihre nächste Arbeitsschicht beginnt. Und eine Mutter, die aus freien Stücken 80 Prozent oder mehr arbeitet, erntet hochgezogene Augenbrauen und muss damit rechnen, dass nicht wenige sich fragen, warum sie überhaupt Mutter sei, wenn sie doch so viel Zeit weg von den Kindern verbringt. Die Folge: Sie macht einen Top-Job und setzt sich im Privaten noch stärker unter Druck, allen zu beweisen, was für eine tolle Mutter sie ist, selbst gemachte Cupcakes für die ganze Klasse am Geburtstag eines Kindes inklusive.»
Ich muss gestehen, dass ich überrascht war, einen derartigen Artikel im Blick zu lesen. Positiv überrascht, weil das Thema die grosse Reichweite der Massenmedien verdient, aber lange nicht bekam. Bei zu vielen Menschen scheint noch nicht angekommen zu sein, dass unser System davor steht, zu kollabieren. Die Geburtenraten sinken schon seit einigen Jahren, während die Generation der Baby-Boomer ins Pensionsalter kommt, was unser Rentensystem über kurz oder lang massiv in Schieflage bringen wird. Gleichzeitig kämpft die Wirtschaft mit einem ausgeprägten Fachkräftemangel.
Hinzu kommen die Kosten, die die kollektive Erschöpfung generiert. Laut einer Auswertung der PK Rück haben die allgemeinen Arbeitsausfälle wegen psychischer Erkrankungen in der Schweizer Wirtschaft bereits 2022 ein Rekordhoch erreicht. Dabei seien die betroffenen Arbeitnehmenden viel länger abwesend als bei anderen Krankheiten. Im Schnitt sind es elf Monate. Laut der aktuellen SRG-Studie kosten diese Ausfälle und der Produktivitätsverlust die Arbeitgebenden jährlich 6.5 Milliarden Franken. Hinzu kommen die Gesundheitskosten, die bekanntlich rapide steigen und zu laufenden Erhöhungen der Krankenkassenprämien führen. Ich habe mir die Mühe gemacht, alle meine Arztrechnungen der letzten 1.5 Jahre rauszukramen und die Kosten für Therapie, Medikamente, Klinikaufenthalt etc. zusammen zu rechnen: 50’000 Franken hat meine Krankenkasse bisher für mein Burnout hingeblättert. Und das ist nur ein einziger Fall!
Ich hoffe, es wird deutlich, dass wir es uns schlicht nicht leisten können, Mütter weiterhin im Stich zu lassen. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen endlich umdenken, weg von veralteten Rollenbildern und in Richtung Zukunft. Wir müssen aufhören, Frauen zu kritisieren und zu diskriminieren, und sie stattdessen dankbar und mit voller Kraft unterstützen, wenn sie sich bereit erklären, sowohl Kinder zu bekommen als auch in der Wirtschaft aktiv zu sein. Damit wir die jetzige Situation lieber früher als später wirklich nur als tragische Übergangsphase verbuchen können.
Wie seht ihr das? Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf unseren Social-Media-Kanälen dazu austauschen!
Herzlichst,
Julia