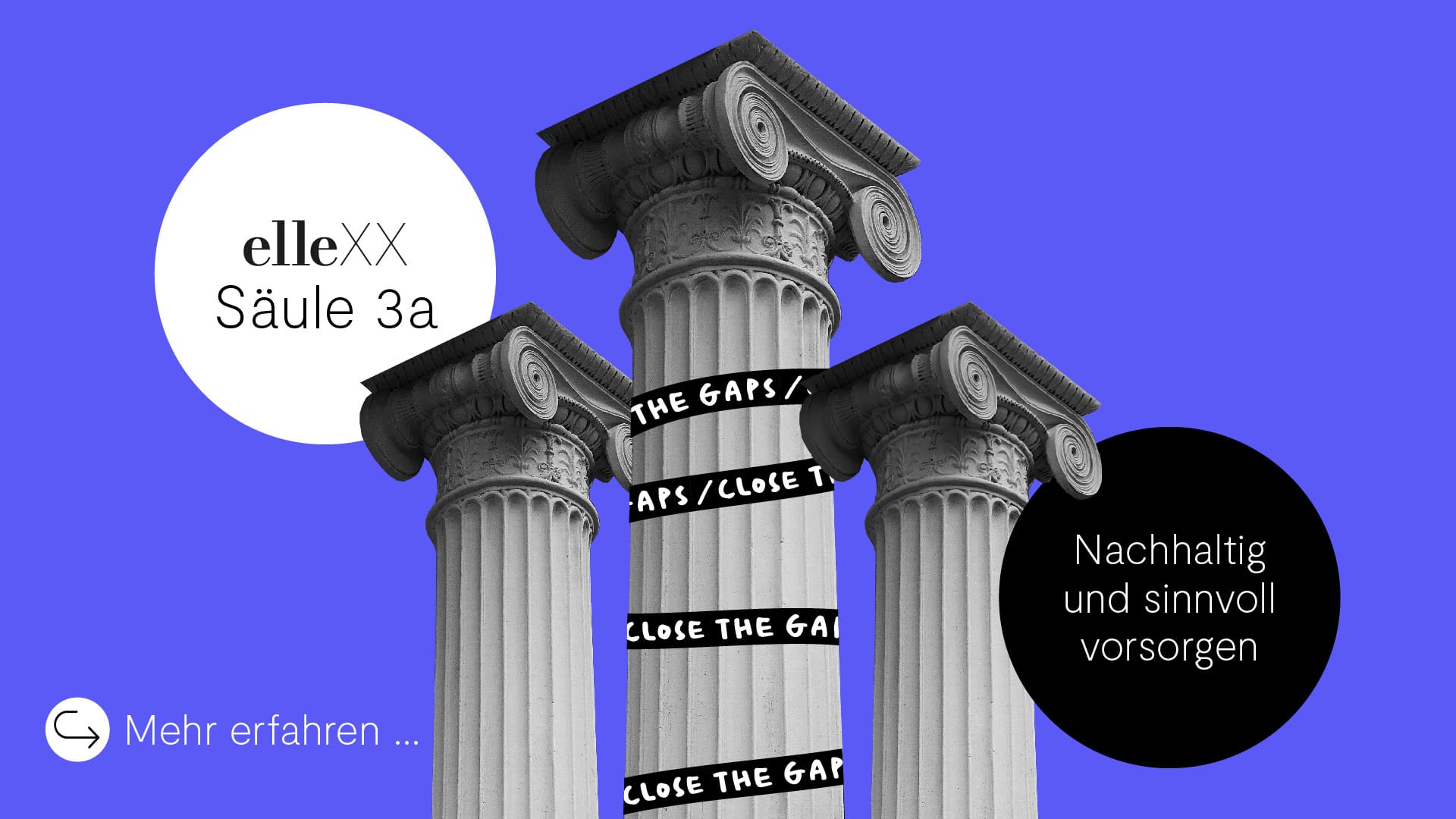Als ich letztes Wochenende mit meiner besten Freundin den Kinosaal betrat, um mir «Barbie» anzusehen, hatte ich keine grossen Erwartungen. Trotz tonnenschwerem Marketingbudget ging die Promo für den Film irgendwie an mir vorbei. Ich hatte mir vorab noch nicht einmal den Trailer angesehen.
Nach dem Film blieben wir noch einige Minuten sitzen und wischten uns ein paar Tränchen aus den Augen. Mich hat der Film gleichzeitig prima unterhalten und an der einen oder anderen Stelle mitten ins Herz getroffen. Auf dem Nachhauseweg beschäftigte mich aber dennoch die Frage: Kann ich als Feministin etwas gut finden, das ganz klar Teil einer Marketingstrategie ist, die Mattel ein bisschen besser dastehen lassen soll? Schliesslich hat der Spielzeugriese und Barbie-Hersteller den Film mitproduziert.
Immerhin steht Mattel seit Jahrzehnten in der Kritik, kleinen Mädchen unrealistische Schönheitsideale zu vermitteln. Zwar gibt es seit einigen Jahren mehr Diversität in Barbieland – etwa Puppen mit verschiedenen Hautfarben oder eine im Rollstuhl –, gleichzeitig verantwortet Mattel aber auch eine Barbie, die mit Abnehmtipps daherkam; inklusive Büchlein mit der Aufschrift «don’t eat». Fair enough, das ist bereits ein paar Jahrzehnte her, aber es ist klar, dass sich der Spielzeughersteller in der Vergangenheit doch ein paar grosse Patzer geleistet hat, die es nun zu bereinigen gilt.
Das lässt man sich natürlich gerne etwas kosten: Genau beziffern lässt sich nicht, wie viel ausgegeben wurde, konkurrierende Firmen gehen aber von etwa 150 Millionen Dollar aus. Sogar vor Google wurde kein Halt gemacht: Gab man in der vergangenen Woche «Barbie» ins Suchfeld ein, glitzerte der ganze Bildschirm Pink. Auf der elleXX Redaktion munkelt man übrigens gar, dieser Clou habe bereits einen Mann dazu verführt, sich den Film im Kino anzusehen.
Das Marketingbudget lohnte sich jedenfalls: Nach nur drei Tagen spielte der Film in den USA 356 Millionen Dollar ein, und in der Schweiz stürmten am Eröffnungswochenende 45’000 Besucher:innen die Kinosäle. Greta Gerwig, die bisher vor allem Indie-Produktionen auf die Leinwand brachte, erreichte damit tatsächlich Bahnbrechendes: «Barbie» ist der bisher wirtschaftlich erfolgreichste Film einer Regisseurin.
Nun könnte man zynisch sein und sagen, dass Mattel natürlich ganz genau weiss, wie der Zeitgeist tickt. Und damit hätte man recht: 2023 einen Film über die Schönheits-Ikone unserer Kinderzimmer herauszubringen und ihn als popfeministisch zu labeln, ist ganz schön smart. Man könnte noch etwas zynischer sein und sich darüber aufregen, dass mit «Barbie» feministische Ideologien kapitalisiert werden – von einem Grossunternehmen, das selbst fett von patriarchalen Strukturen profitiert. Und auch damit hätte man recht.
Man könnte sich aber auch zurücklehnen – dafür, liebe Leser:innen, habe ich mich entschieden – und den Film einfach als das geniessen, was er ist. Es ist nämlich durchaus möglich, einen Film kritisch zu hinterfragen und ihn trotzdem lustig und berührend zu finden. Die Kinowelt ist schliesslich schon lange nicht mehr schwarz-weiss. «Barbie» ist ein wunderbar unterhaltsamer Blockbuster, der gleichzeitig dafür sorgen könnte, dass auch in Zukunft mehr Filme von und über Frauen in die Kinos kommen. Weil es eben Zeitgeist ist, Projekte von Frauen zu fördern. Nicht nur weil sie Frauen sind, natürlich, sondern weil sie einfach richtig gut sind. Und weil sie vor allem einen Markt bedienen, der bisher besonders von Hollywood beschämend vernachlässigt wurde. Wie viele Filme hast du in den letzten Jahren gesehen, die die Welt der Frauen in den Mittelpunkt stellen? Und wie viele über Männer? Eben.
«Barbie» kommt nicht nur quietschbunt, wahnsinnig lustig und pointiert daher, sondern zeigt auch die Schönheit, Wichtigkeit und die Poesie von Frauenbünden. Es gibt diesen einen Monolog im Film, der mir in Erinnerung blieb: America Ferrera (wunderbar warmherzig in der Rolle als Mutter eines Teenie-Mädchens) erzählt Barbie, wie unfair das Leben als Frau sein kann. Wie man eigentlich nichts richtig machen kann. Und führt durch diese Absurdität vor, dass einem dadurch eigentlich erst recht alle Tore zur Welt offenstehen.
Diesen Monolog habe ich schon oft in verschiedenen Ausführungen gehört, neu war nichts daran für mich. Aber um mich geht es dabei nicht. Es geht um das 12-jährige Mädchen, das den Film im pinken Tüllrock mit seiner Mutter schaut. Um die 64-jährige Oma, deren Enkelin im Kinosessel nebenan «Barbie»-Fan ist. Und ein bisschen geht es auch um den 33-jährigen Freund, der bloss seiner Partnerin zuliebe ein Kinoticket gekauft hat. Die Chancen sind gross, dass es in einigen Köpfen «Klick» gemacht hat am vergangenen Wochenende. Ein «Klick», das vielleicht dazu führt, beim nächsten frauenfeindlichen Witz nicht mehr zu schweigen. Beim Blick in den Spiegel einen etwas wärmeren Blick auf sich selbst zu haben. Sich vor der nächsten Abstimmungen ganz genau zu überlegen, inwiefern Frauen von meiner Stimme profitieren – oder ob sie ihnen schadet.
Dass konservative US-Politiker den Film am liebsten sofort verbieten würden, weil er angeblich Männerhass verbreitet und die LGBT-Agenda hilflosen Kindern aufdrängen will, darf man im aktuellen gesellschaftlichen Klima durchaus positiv werten: Das Patriarchat bäumt sich auf, weil es sich bedroht fühlt. Gut so. Insofern könnte «Barbie» durchaus ein weiteres Puzzleteil für einen gesellschaftlichen Wandel darstellen, ein Schritt im High Heel nach dem anderen. So hat es sich für einmal gelohnt, dass feministischen Botschaften ein pinker Overall übergestülpt wurde.



.jpg-.jpg)