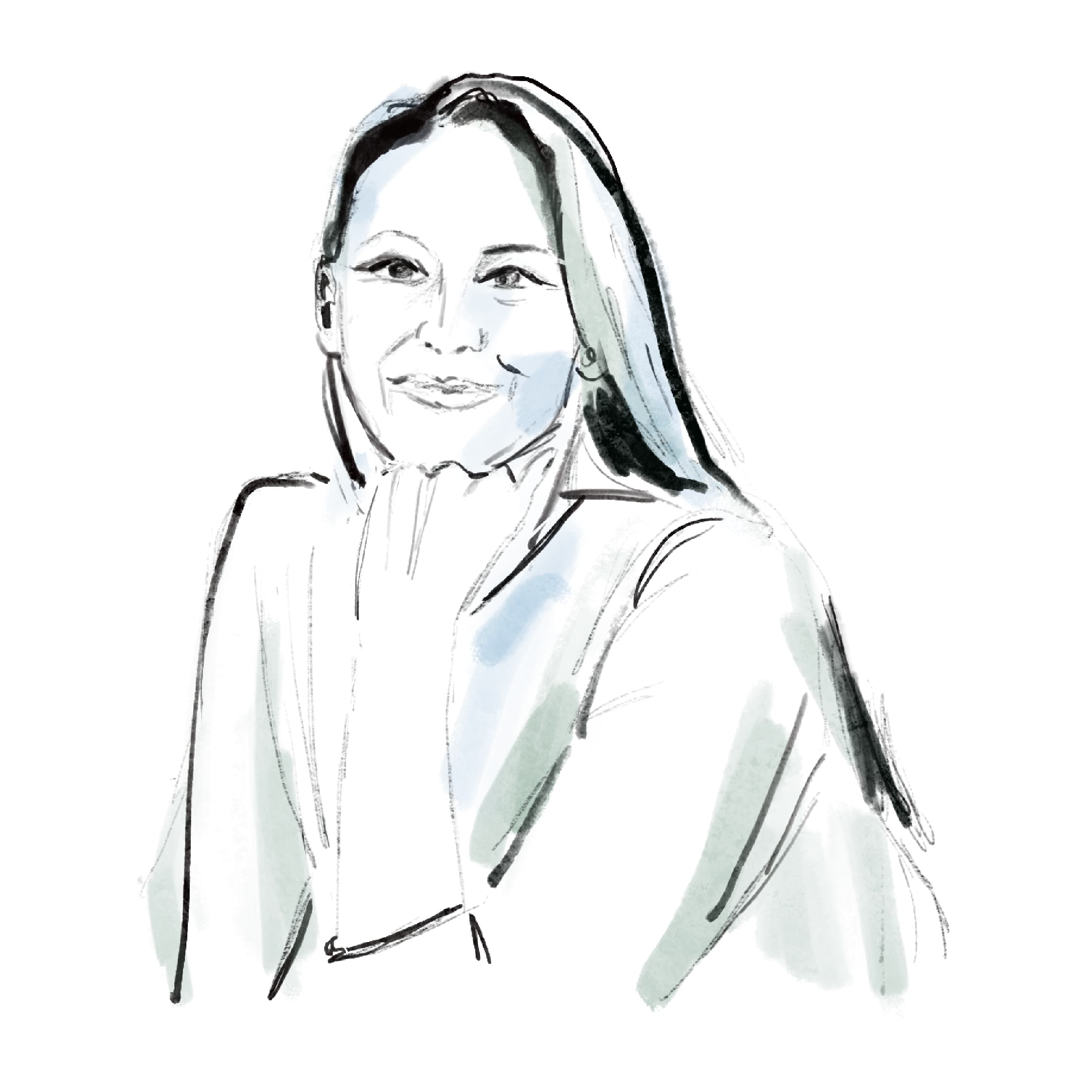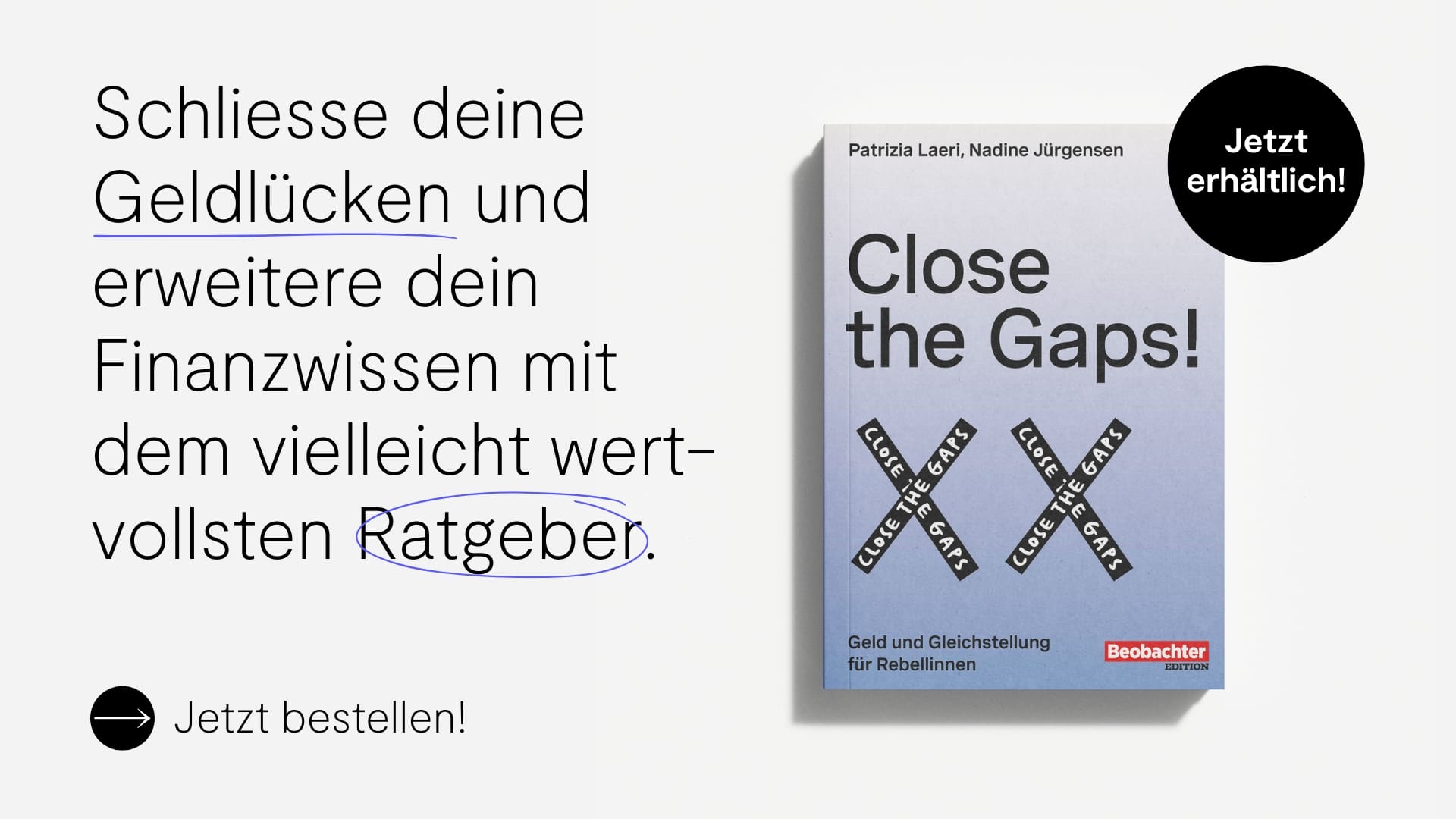Seitdem ich mich vor etwas mehr als einem Jahr auf LinkedIn als Burnout-Überlebende geoutet habe, habe ich viel schönes Feedback erhalten. Dass sich all diese Menschen Zeit nehmen, mir Nachrichten zu schreiben oder mich an Events anzusprechen, um mir für meinen Mut zu gratulieren und sich zu bedanken, berührt mich sehr.
Kürzlich wurde ich jedoch zum ersten Mal gefragt, wie ich den Mut für diese Offenheit gefunden habe. Weil das Thema «ja doch noch sehr stigmatisiert» sei und das Ganze auch «nach hinten hätte losgehen können». «Mmh», machte ich, und dann blubberte aus mir heraus: «Weisst du, eigentlich fand ich es schwieriger, mich als Feministin zu outen.»
Wo genau aus meinem Körper diese Aussage herkam, wusste ich in diesem Moment selbst nicht. Sie führte jedoch zu einer sehr spannenden Diskussion. Darüber, wie negativ konnotiert der Begriff «Feminist:in» in vielen Kreisen bis heute ist. Dass sich selbst Angela Merkel bei einem Auftritt an der W20-Frauenkonferenz offensichtlich unwohl gefühlt hatte, als sie gefragt wurde, ob sie Feministin sei. Darüber, wie ich mich in ihrer Situation bis vor einigen Jahren vermutlich ähnlich geziert hätte.
Ich erzählte meinem Gegenüber, dass ich mich zum Beispiel noch sehr gut an den 14. Juni 2019 erinnern könne. An diesem Tag wurde es plötzlich laut im Schweizer Verlagshaus, in dem ich seit sechs Jahren lohnarbeitete. Kolleg:innen aus verschiedenen Redaktionen liefen mit lautem Getrommel durch die Gänge und forderten alle auf, an den ersten grossen feministischen Streik in der Schweiz seit 1991 mitzukommen.
Ich blieb sitzen, schüttelte den Kopf und starrte stoisch in meinen Bildschirm: «Ich muss arbeiten», war das einzige, was ich herausbrachte. Ich hatte das Gefühl, das Ganze ginge mich nichts an. Ich war im sechsten Monat schwanger und hatte soeben eine Beförderung in die Redaktionsleitung verhandelt. Diese würde ich nach meiner auf ein halbes Jahr verlängerten Baby-Pause antreten. Mein damaliger Partner und ich konnten es uns leisten, genau wie die horrenden Kosten für fünf Tage Kita im Anschluss.
Das gab mir das Gefühl, ich sei der lebende Beweis dafür, dass man nur hart genug arbeiten müsse, dann sei alles möglich. Ausserdem wollte ich mir auch meinen Ruf in den oberen Etagen nicht kaputt machen. I mean … Wie hätte es für die überwiegend männliche Runde denn ausgesehen, wenn ich mich diesem Rudel «wilder Frauen» angeschlossen hätte?
Erst drei Jahre später, inzwischen Mutter einer kleinen Tochter und mit beiden Beinen tief in der Erschöpfungsdepression steckend, fing ich an zu sehen und zu verstehen. Einerseits, wie privilegiert ich als weisse Frau mit guter Ausbildung und meiner Lohnklasse war. Andererseits, wie diskriminierend unser gesellschaftliches System noch immer ist. Und wie sehr die Sozialisierung und das Leben im Patriarchat negativen Einfluss auf mein sowie das Leben aller anderen (auch auf das der Männer) nimmt.
Wie es zu diesem Sinneswandel kam? Bücher! Sehr viele Bücher! Ich war aus dem Hamsterrad geflogen und hatte aufgrund meiner Erkrankung plötzlich wieder Zeit zu lesen. Ganze 1,5 Jahre, um genau zu sein. Meine Reise zur bekennenden Feministin begann mit dem Roman «Die Wut, die bleibt» der österreichischen Autorin Mareike Fallwickl (grosse Empfehlung!). In den Monaten danach folgten circa 200 weitere, ausschliesslich von Frauen verfasste Romane, Sachbücher und Essaybände. Mit jedem einzelnen wurde ich wütender. Auf mein altes Ich, aber vor allem auf das System, in dem wir leben.
Irgendwann folgte das, was ich heute gern als «Mutausbruch» bezeichne. Ich entschied mich, in die Sichtbarkeit zu treten, wobei mein Burnout eigentlich nur eine Randnotiz war. Das Ergebnis der systematischen Unterdrückung von Frauen. Ich wollte aber vor allem offen über meine Geschichte sprechen, weil ich verstanden hatte, dass die Anliegen von Frauen immer noch zu oft unter den Tisch fallen. Dass wir zu fest damit beschäftigt sind, die fleissigen Bienli zu geben, wie es von uns erwartet wird. Im Lohnjob und daheim. Dass viele von uns zu erschöpft sind von diesem Spagat, um uns Gedanken zu machen und uns für Gleichberechtigung zu engagieren. Dass viele von uns nicht laut sind, weil es sich als Frau nicht ziemt, wütend alias wild zu sein. Weil wir die Konsequenzen scheuen.
Und, dass viele von uns es schlicht nicht besser wissen und deshalb nicht wütend (genug) sind. So wie ich, damals, am 14. Juni 2019.
Heute, mit all dem Wissen, das ich in mich aufgesogen habe, hätte ich kein Problem mehr damit, mir «Feministin» gut sichtbar auf den Körper tätowieren zu lassen, wenn es zur Veränderung beitragen würde. Weil ich verstanden habe, was Menschen erreichen wollen, die sich als Feminist:innen bezeichnen. Nämlich Gleichstellung. Und zwar für alle Menschen. Und damit nichts anderes als Gleichberechtigung und Fairness. Und ich denke mir: «Wer könnte das nicht wollen?» Doch nur diejenigen, die kein Mitgefühl haben oder kein Problem darin sehen, dass es anderen schlecht(er) geht?
Zu diesen Menschen zähle ich mich definitiv nicht. Du? Vermutlich auch nicht. Wieso also empfinden es so viele von uns als unangenehm, uns als Feminist:innen zu bezeichnen?
Ich denke, einerseits, weil der Begriff vom lateinischen «femina», also «Frau», abgeleitet ist. Was der Tatsache geschuldet ist, dass es Frauen waren, die sich als erste für Gleichstellung einsetzten. Andererseits, weil der Begriff und alle, die sich als Feminist:innen out(et)en, von den Reichen und Mächtigen, also meist Männern, verunglimpft und ins Lächerliche gezogen wurden und immer noch werden.
Wenn wir uns jedoch bewusst machen, dass diese Reaktion ein Zeichen der Angst ist, wird es vielleicht leichter. Die Angst davor, den Kuchen teilen zu müssen und sich anständig gegenüber allen Menschen verhalten zu müssen. Aber das gehört nun mal zu einem gelingenden Zusammenleben dazu. Das predige ich auch meiner Tochter jeden Tag – und schäme mich kein bisschen dafür.
Was ich sagen will: Ich verstehe, dass es unangenehm ist. Und doch glaube ich, dass es nie zu spät ist, sich weiterzubilden und die eigene Einstellung zu hinterfragen. Und dann dazu zu stehen, auch wenn es unbequem ist.
Julia Panknin ist selbstständige Journalistin, Speakerin und Beraterin mit Fokus auf die Themen Parental Burnout und Vereinbarkeit von Kind und Karriere, Gründerin von mamibrennt.com sowie Verantstalterin der Party-Reihe «mamiTanzt». Die Münchnerin lebt seit 15 Jahren in der Nähe des Zürichsees und hat eine kleine Tochter, die sie 50:50 im Wechselmodell mit deren Vater betreut.