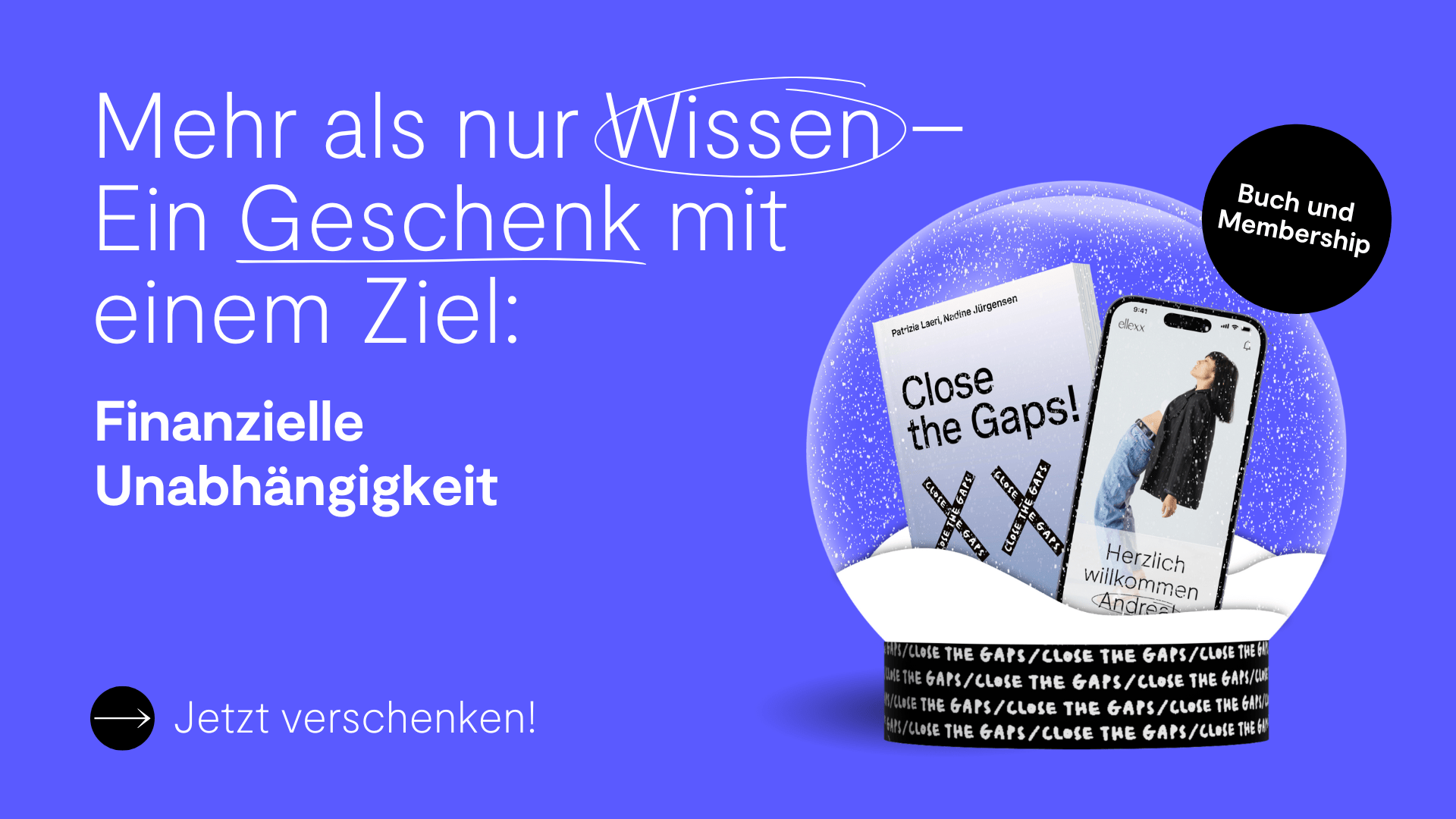In Ihrem ersten Buch ging es um die Erschöpfung der Frauen, Ihr neues Buch handelt von weiblicher Verbundenheit. Wie kam es zu dem Wandel von systemkritisch zu hoffnungsvoll?
Im ersten Buch schrieb ich bereits, dass ich die Verbündung der Frauen für eine zentrale Strategie gegen ihre Erschöpfung halte. Damit habe ich das neue Buch schon angelegt, ohne dass ich es damals wusste. Ich bin dann in den letzten Jahren, in denen ich mit dem Erschöpfungsbuch unterwegs war, immer wieder an den Punkt gekommen, an dem ich dachte: Die patriarchatskritische Bestandesaufnahme unserer Gesellschaft ist wichtig, aber ich möchte auch mehr in utopischen Möglichkeiten schreiben.
Warum sind Utopien und Möglichkeiten so wichtig, gerade aus einer feministischen Perspektive?
Wenn wir nur kritisieren, laufen wir Gefahr, Frauengeschichte und -Erfahrungen dauernd als defizitär zu erzählen. Als eine Geschichte von Ausschluss und Diskriminierung. Diese Geschichte stimmt natürlich, aber es gibt gleichzeitig eine andere Geschichte – die des weiblichen Eigensinns, der rebellischen Verbündung gegen das Patriarchat. Ich wollte aufzeigen, dass die Geschlechterrevolution auch eine Erfolgsgeschichte ist. Dass Frauen es geschafft haben, sich trotz schlechter Bedingungen zu verbünden – oft auch über politische Lager und Grenzen hinweg. Auch im Privaten haben Frauen sich durch Beziehungen immer wieder gegenseitig Freiheit und Emanzipation ermöglicht.
Warum halten Sie es auch trotz Gleichstellungsbemühungen in unserer modernen Welt für wichtig, feministische Utopien aufzuzeigen?
Das kapitalistisch-neoliberale System wird häufig als alternativlos dargestellt. Auch der sogenannte «Gleichstellungsfeminismus» bleibt oft bei der Vorstellung stehen, dass Frauen dann befreit sind, wenn sie im bestehenden System gleich viel Macht und Ressourcen wie die Männer haben. Natürlich ist es richtig, dass Frauen gleich viel Lohn wollen und Führungspositionen besetzen möchten. Nur weil wir Bundeskanzlerinnen haben oder Frauen in Chefpositionen, bedeutet das aber noch lange nicht, dass Macht, Einfluss und Ressourcen von einigen Frauen sich automatisch von oben nach unten verteilen. «Trickle down» ist ein neoliberaler Mythos. Wenn ein paar Frauen obenauf schwimmen, bedeutet das für einen grossen Teil der Frauen noch lange keine Veränderung. Seit Jahrzehnten warten und hoffen wir auf «trickle down», aber es passiert nicht. Wohlstand und Macht sickern nicht von alleine nach unten, eher das Gegenteil ist der Fall: Sie verteilen sich auf immer weniger Menschen. Meist auf jene, die bereits privilegiert sind.
Was wäre die Alternative?
Ich halte die Forderung nach Gleichstellung innerhalb des Bestehenden für zu kurz gedacht – wir wollen doch mehr als das. Wenn ich mir anschaue, was gegenwärtig abgeht – Kriege, Machtmissbräuche, zunehmende Ungleichheit und so weiter –, dann halte ich das nur bedingt für ein erstrebenswertes System, an dem wir teilhaben wollen. Wir sollten wieder mehr Mut haben, eigene Freiheitsmodelle zu entwickeln und die bestehende Ordnung zu hinterfragen.
Sie sagen, Frauen haben es geschafft, sich trotz schlechter Bedingungen immer wieder zu verbünden. Warum sind die Bedingungen schlecht?
Zum einen leben wir in einem neoliberalen Wettbewerb, in einer Struktur der Vereinzelung mit dem Credo: «Jeder Mensch ist seines eigenen Glückes Schmied.» Gleichzeitig gibt es aber nur wenige gute Plätze, und deshalb macht uns dieses System zu Konkurrent:innen. Das betrifft nicht nur die Frauen, sondern alle Menschen. Wir werden dauernd in einen Wettbewerb gebracht, wir werden gespalten in Besitzende und Lohnabhängige, in Arme und Reiche, in Privilegierte und weniger Privilegierte – wir kämpfen um einen Platz an der Sonne, um ein Stück vom Kuchen. In meinem Buch geht es nun spezifisch um die Frage, inwiefern die patriarchale Ordnung besonders spaltend für Frauen ist.
Inwiefern?
Da Männer immer noch einen grossen Teil aller Machtpositionen innehaben und finanziell besser gestellt sind, müssen Frauen sich oft an Männern orientieren, sich mit ihnen gut stellen, wenn sie durchkommen oder etwas erreichen wollen. Frauen müssen sich in die Gunst der Männer stellen und gegenüber Männern loyal sein, wenn sie in unserem System etwas erreichen wollen. Während sie mit anderen Frauen eher in Konkurrenz gebracht werden.
Dieses Bild der Frauen als Gegnerinnen sehen wir auch in Geschichten und Märchen. Stichwort: Schneewittchen oder Aschenbrödel…
Genau, die böse Stiefmutter, die ihre eigene Tochter umbringen will, um die Schönste im ganzen Land zu sein. Die Mutter, die ihre Töchter dazu zwingt, sich Teile ihrer Füsse abzuhacken, um den Prinzen zu bekommen. Oder Frau Holle, die junge Mädchen in fleissige und faule einteilt – die Fleissigen werden mit Goldregen belohnt. Das sind alles Geschichten, in denen Frauen zu Vollstreckerinnen des Patriarchats werden, in denen Frauen andere Frauen passförmig machen für die Erfüllung patriarchaler Anforderungen. Wie in diesen Geschichten teilt uns auch die gegenwärtige misogyne Gesellschaft ein in gute und schlechte Frauen, in hübsche und hässliche Frauen, in fleissige und faule Frauen. Diese Einteilung ist auch bei den Frauen selbst oft tief verankert, häufig haben sie selbst einen sexistisch bewertenden Blick auf Geschlechtsgenossinnen.
Sie zitieren in dem Zusammenhang die amerikanische Schriftstellerin bell hooks, die sagt: «Die lauteste patriarchale Stimme in meinem Kopf war die meiner Mutter.» Frauen sind also häufig Patriarchatskomplizinnen?
Ja. Studien zeigen, dass Frauen untereinander viel strenger sind als Männer. Natürlich stehen Männer auch in einem harten Wettbewerb zueinander, aber sie haben eine positivere Meinung voneinander als die Frauen. Die sexistisch-abwertende Haltung anderen Frauen gegenüber müssen wir uns abtrainieren. Ich plädiere aber nicht für ein unkritisches Abfeiern voneinander; Verbundenheit soll keine Zwangsharmonisierung sein. Es geht darum, miteinander auf Augenhöhe zu streiten, ohne einander abzuwerten.
Kommen wir zum Thema Freundschaft, dem Sie ein ganzes Buchkapitel widmen. Sie schreiben, dass Frauen zwar durch ihre zunehmende Erwerbsarbeit mehr Beziehungen auch ausserhalb der Familie aufbauen, diese aber häufig nutzenorientiert sind. Warum?
Sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext werden Frauenbeziehungen häufig auf einen Nutzen reduziert. Im beruflichen denke ich da zum Beispiel an diese Netzwerkevents, die Frauen wahrnehmen sollten, um sich Karrieremöglichkeiten zu eröffnen. Das ist nicht per se falsch, aber es ist eine Reduktion der Frauenbeziehungen auf kapitalistische Nutzenorientierung. Dabei könnten Frauenbeziehungen viel mehr sein, sie könnten persönliches Wachstum, Weiterentwicklung und Erfüllung ermöglichen.
Und im privaten Kontext?
Vor allem Mütter sind oft auf andere Frauen angewiesen, um Beruf und Familie zu vereinen. Zum Beispiel auf Freundinnen, Mütter und Schwiegermütter, die den Mittagstisch organisieren. Das sind wichtige Beziehungen, und ich möchte die nicht abwerten, aber sie sind oft sehr nutzenorientiert. Frauen gehen sie ein, weil sie sie brauchen, um den Alltag bewältigen zu können, nicht, weil sie denken: Das ist eine interessante Frau, mit ihr möchte ich meine Persönlichkeit weiterentwickeln. Moderne Frauen sind also oft auf Beziehungen angewiesen, die sie erneut re-traditionalisieren, weil sie sie verpflichten, etwas zurückzugeben – auch einen Mittagstisch anzubieten, zum Beispiel. Das heisst, Frauen bleiben auch in ihren Frauenbeziehungen oft in dieser Rolle der Gebenden gefangen. In meinem Buch denke ich deshalb über Frauenfreundschaften nach, die dieser Nützlichkeitsfalle etwas entgegensetzen.
Heisst das, die Ehe und das klassische Familienmodell reduzieren Freundschaften unter Frauen?
Ja, weil Frauen dann häufig aufgefressen werden von dieser Verfügbarkeit für die Familie. Leider trauen sie sich häufig nicht, dies in Frage zu stellen, und denken, sie müssten ihre gesamte Freizeit und Beziehungskompetenz für die Familie aufopfern. Ich plädiere dafür, die individuellen Spielräume auszunutzen und gewisse normative Vorstellungen über Familie zu hinterfragen. Konkret zum Beispiel haben mein Partner und ich uns bewusst entschieden, dass wir nicht jeden Abend alle zusammen essen. Wir haben früh gesagt, es reicht, wenn eine Person von uns da ist und die Familienabende auf einen bis zwei pro Woche reduziert werden. So haben beide die Möglichkeit, auch Freund:innen zu treffen. Ausserdem ist meine Erfahrung, dass die Familien- und auch die Paarzeit schöner wird, wenn sie weniger, dafür bewusster und gewollter gestaltet wird und nicht einfach ein Automatismus ist.
Sind Beziehungen ohne Nutzen eine Art Luxus?
Ja, Zahlen belegen das. Je privilegierter Frauen sind, desto eher haben sie Zeit für Freundschaften. Je ärmer Frauen sind, desto weniger Möglichkeiten für Mobilität und Freizeit haben sie.
Sie sehen Freundschaften zwischen Frauen als emanzipatorisch. Inwiefern?
Freundschaften zwischen Frauen können ihnen ermöglichen, sich von der Idee zu lösen, dass es nur eine erfüllende Partnerschaft gibt und dass eine Frau defizitär ist, wenn sie keinen Mann an ihrer Seite hat. Tragende und starke Frauenbeziehungen erlauben es Frauen, weniger abhängig von Männern zu sein und zum Beispiel auch aus toxischen Beziehungen auszusteigen. Wenn möglich sollten wir uns mehr Zeit nehmen für Freundinnen, das ist aus meiner Sicht wichtig für ein persönlich emanzipiertes Leben.
Auch im historischen Kontext waren Frauenfreundschaften emanzipatorisch, denn von den grossen Denkern wurden sie gar nie mitgedacht?
Freundschaftstheoretiker wie Aristoteles oder Michel de Montaigne haben Freundschaft immer männlich gedacht, als eine Beziehung zwischen zwei Subjekten, die sich auf Augenhöhe begegnen und sich gegenseitig befruchten. Aus der Männerfreundschaft entstünden, so die Theorie, wichtige philosophische Werke und Politik. Es wurde immer als etwas Bedeutendes angesehen, wenn Männer sich aufeinander beziehen. Während die Frauenbeziehung als unwichtig galt, als Kaffeekränzchen-Beziehung. Frauen wurden nicht als rationale Subjekte betrachtet, sondern als emotional und somit auch nicht als fähig, gewichtige Beziehungen zu führen. Dieser Vorstellung haben sich Frauen in ihrer Freundschaftspraxis immer widersetzt. In den Brieffreundschaften des 18. Jahrhunderts können wir nachvollziehen, wie Frauen Freundschaft als eine emanzipatorische Praxis lebten, sich etwa gegenseitig Subjektstatus ermöglichten und auch ihr politisches Denken förderten.
Sie schreiben von einem narzisstischen männlichen Freundschaftskonzept. Inwiefern unterscheiden sich männliche Freundschaftskonzepte von weiblichen?
In den männlichen Freundschaftskonzepten geht es häufig um eine Beziehung, in der zwei Männer sich narzisstisch spiegeln und ihre Egos aufblähen. Heute sehen wir eine solche Praxis etwa in der Beziehung zwischen Elon Musk und Donald Trump, das sind zwei Super-Egos, die sich gegenseitig zu noch grösseren Super-Egos machen. Die Frauenfreundschaften, die ich im Buch beschreibe, zeigen ein anderes Modell, hier geht es weniger um die narzisstische Spiegelung, sondern darum, einander zu ermöglichen, eigensinnige Persönlichkeiten zu entwickeln.
Leider idealisieren sich aber nicht nur Männer gegenseitig, sondern auch Frauen idealisieren häufig Männer. Warum?
Wir leben in einer insgesamt männerverehrenden Gesellschaft. Was von Männern kommt, wird umjubelt, ins Zentrum gestellt und für wichtig befunden, sei es in Sport, Kultur, Politik oder Wirtschaft. Und das reproduzieren leider auch die Frauen selbst.
Sie zitieren zum Beispiel ein Buch, in dem Führungsfrauen darüber sprechen, was sie von ihren Vätern mitbekommen haben.
In «The Managerial Woman» wurden erfolgreiche Frauen befragt, von wem sie geprägt wurden und warum sie erfolgreich sind. Und sie alle erwähnen als erstes ihre Väter und dass diese sie gefördert hätten. Das ist toll, aber man fragt sich, warum der Anteil der Mütter mit keinem Wort erwähnt wird. Ich bin sicher, dass die Mütter auch einen Anteil an der Biografie dieser Frauen haben, auch wenn es nicht sofort auf der Hand liegt und der Anteil der Mütter vielleicht weniger glamourös klingt. Auch für Frauen macht sich die Erzählung besser, von Männern, von Vätern beeinflusst worden zu sein und Frauen auszublenden. Das überrascht nicht in einer Gesellschaft, die das Wichtige mit Männlichkeit gleichsetzt, während Dinge wie Care-Arbeit als unwichtig und weiblich gelten. Auch Frauen neigen deshalb dazu, die Bedeutung von Männern in ihrem Leben für grösser zu befinden als die Bedeutung von Frauen.
Sie beschreiben in Ihrem Buch auch Ihre eigene Erfahrung ...
Ja, auch ich habe mich auf die Suche nach meiner eigenen Familiengeschichte begeben und mir die Frage gestellt: «Wie haben mich Frauen geprägt?» Ich selbst habe etwa zur Wahrnehmung tendiert, dass ich von meinem Vater politisiert wurde, dass er derjenige mit den politisch-philosophischen Interessen war. Ich musste dann merken, dass das gar nicht stimmt. Meine Mutter hat einen erheblichen Anteil an meiner Politisierung, den ich aber erst aufspüren musste.
Diese Männerverehrung beginnt bereits im Kindesalter?
Ja, Söhne werden oft anders behandelt als Töchter, sie werden mehr «bejubelt» oder gelobt. Viele Mädchen machen bereits in ihrer Kindheit die Erfahrung, dass sie sich mehr anstrengen müssen, um Anerkennung zu erhalten. Aus der Forschung wissen wir zum Beispiel, dass Eltern mit ihren Töchtern strenger sind als mit Söhnen, dass sie etwa unangepasstes Verhalten bei Töchtern eher sanktionieren als bei Söhnen. Ein weiteres Beispiel: Geschiedene Väter engagieren sich durchschnittlich mehr für ihre Kinder, wenn ein Sohn da ist. Kurzum: Die Männerverehrung zeigt sich in vielen Mikroverhaltensweisen.
Was macht es mit Mädchen, wenn Frauen sowohl privat als auch gesellschaftlich unsichtbar sind?
Wenn Mädchen in der Schule beispielsweise nichts über Frauengeschichte lernen, haben sie kein Identifikationsangebot und verinnerlichen dieses männerorientierte Bild der Gesellschaft. Eine eigene Geschichte zu haben, hat eine befreiende Wirkung. Wenn ich mich zum Beispiel frage, inwiefern meine Mutter oder andere Frauen mich geprägt haben, versuche ich eine feministische Erzählweise über mein eigenes Leben zu entwickeln. Ich halte es für eine emanzipatorische Praxis der Verbindung, uns den Einfluss von Frauen auf unser Leben und auf die Geschichte der Menschheit bewusst zu machen. Das können durchaus auch schmerzhafte Geschichten sein; Frauen sind ja nicht die besseren Menschen, der Einfluss von Frauen kann auch ein schwieriger sein. Es geht mir nicht darum, einander zu idealisieren, sondern eine kritische Auseinandersetzung möglich zu machen.
Inwiefern muss Verbundenheit aktiv erarbeitet werden?
Verbundenheit erfordert zunächst Arbeit an unserem Bewusstsein. Unsere grundsätzlich spaltende Gesellschaft macht Verbundenheit nicht selbstverständlich. Deshalb müssen wir bewusst in die Solidarität investieren – im Grossen und im Kleinen. Nicht zuletzt: Auch Solidarität ist nicht davor gefeit, Macht und neue Ausschlüsse zu reproduzieren. Es gilt, immer selbstkritisch zu bleiben. Ich versuche, in meinem Buch Solidaritätspraxen zu erschliessen und gleichzeitig auch Fallstricke aufzuzeigen.