«Wir streiten in der Küche darüber, ob wir Kinder haben sollten. Über das Ende der Welt und das Ausmass meines Ehrgeizes. Und wie viel ist Kunst wirklich wert? ... Ich bin keine Mutter. Ich bin keine Braut. Ich bin König.»
Dieser Songtext der Frontfrau Florence Welch der Band «Florence and the Machine» beschreibt sehr eindringlich die innere Zerrissenheit zwischen der Frau und der Künstlerin, wenn sie sich fragt, ob sie bereit ist, Mutter zu werden und damit vielleicht einen Teil von sich aufzugeben. Den Teil der Künstlerin. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage: Wie viel ist Kunst wirklich wert? Hat sie für die Künstlerin persönlich einen so hohen Stellenwert, dass sie auf das Muttersein verzichtet?
Persönliche Veränderungen prägen die Kunst immer
Doch wieso stellt sich die Frage überhaupt, ob die Frau und Künstlerin etwas aufgeben und sich für eine Rolle entscheiden muss? Ist der Wert, den Frauen in die Kunstwelt tragen, weniger wert, wenn sie dies als Mutter tun? Und weshalb stellen sich diese Fragen vorwiegend Mütter und nicht auch Väter? Die Antwort ist wahrscheinlich einfach – leider zu einfach. In der Kunst verhält es sich wie in der Wirtschaft: Mutter zu werden, führt zu einem Karriereknick. Vater zu werden nicht.
Die Aussage der Kölner Galeristin Anke Schmidt, die mit ihrer Galerie regelmässig auf Kunstmessen wie der Art Basel oder der Art Cologne zu Gast ist, bestätigt dies: «Es geht immer mehr um Investment, um Wertsteigerung. Dann taucht natürlich die Frage auf, wie entwickelt sich der Marktwert einer Künstlerin, die potenziell Mutter wird und dann eben weniger Zeit hat, weniger produktiv ist, oder aber ihr Werk verändert sich durch diese persönliche Veränderung.» Dies sagt eine Frau und Galeristin. Ihre Aussage widerspiegelt das aktuelle Narrativ, in dem wir uns befinden.
Interessant und gleichermassen erschreckend an dieser Aussage ist, dass diese persönlichen Veränderungen im Zusammenhang mit der Mutterschaft gemäss Anke Schmid nicht ebenso spannende und tiefgreifende Kunst hervorbringen können. Dabei vergisst sie, dass sich jeder Mensch aufgrund persönlicher Erlebnisse verändert, nicht nur Frauen, die Mütter werden. Und auch Künstler:innen ohne Kinder machen manchmal unvorhergesehen eine «Kunstpause». Dies wird hier schlicht ausgeblendet.
Anke Schmidt ist nicht die einzige, die diesem Narrativ zum Opfer fällt und in diesem Denken verhaftet ist. Deshalb funktioniert der Kunstmarkt immer noch so, wie er schon seit jeher funktionierte – nämlich vorwiegend mit männlichen Protagonisten. Zeit für eine Überholung.
Kunst befriedigt keine Nachfrage
Das Kunstschaffen ist – sofern die Kunst (noch) nicht zum Hochpreis-Segment gezählt wird – für Frauen und Männer ein Beruf, der im prekären Segment angesiedelt werden muss. Als Künstler:in braucht man Platz zum Experimentieren und sollte nicht dazu gezwungen sein, eine Nachfrage auf dem Markt zu befriedigen. Das wiederum erklärt, wieso es finanziell riskant ist, kunstschaffend zu sein. Kunst wird produziert, ohne zu wissen oder zu analysieren, ob es dafür Käufer:innen gibt. Doch genau darin liegt die Qualität der Kunst: Sie wird nicht dafür geschaffen, irgendeine Funktion zu erfüllen. Vielmehr soll sie die Seele der Gesellschaft nähren. Sie soll inspirieren, hinterfragen und aufrütteln. Kunst soll keinen Markt bedienen, sondern uns intellektuell und emotional bereichern und uns einen gesellschaftlichen Spiegel vorhalten, der nicht immer nur angenehm ist.
Ein Entscheid mit finanziellen Folgen für die ganze Familie
Was heisst das nun aber für kunstschaffende Eltern – und vor allem für kunstschaffende Mütter? Sie haben keinen fixen Lohn, mit dem sie planen können und der es zulässt, sich eine Kita oder Nanny zu leisten. Unser Betreuungssystem ist ausgerichtet auf Eltern, die einen fixen Lohn verdienen. Der andere Teil der Gesellschaft wird ausgeblendet und muss versuchen, sich anderweitig zu organisieren. Als kunstschaffende Mutter ist es äusserst schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, finanziell unabhängig vom Partner zu bleiben und gleichzeitig weiterhin als Künstlerin tätig sein zu können. Es sei denn, der Vater übernimmt seinen Teil der Kinderbetreuung. Ein solcher Entscheid kann wirtschaftliche Rückschritte für die Familie bedeuten und die Frage aufwerfen: Ist es uns das wert?
Es stellen sich grosse Fragen
Die Künstlerin selbst kann diese Frage vielleicht mit Ja beantworten. Aber ist der Partner bereit, all das für das Wohlergehen seiner Partnerin und letztendlich für die Beziehung in Kauf zu nehmen? Und was passiert, wenn sich die Partnerin entscheidet, ihr Kunstschaffen zugunsten der Mutterschaft zurückzustellen? Ist sie dann noch derselbe Mensch und dieselbe Partnerin? Denn die Künstlerin ist Bestandteil ihres Wesens.
Welche Schlüsse man zieht, ist eine Frage der Wert-Schätzung, der Umstände und der Haltung des Partners. Er muss sich fragen: Was schätze ich an meiner Partnerin? Wieso schätze ich sie? Basiert meine Wert-Schätzung auf einer finanziellen Bewertung? Liegt unserer Beziehung eine monetäre Bewertung oder eine emotionale zugrunde? Welche dieser Bewertungen gewichten wir stärker?
Es braucht ein Umdenken
Laura Herter, eine kunstschaffende Mutter, die ihr Kind mitunter auch in einer Kita betreuen lässt, rechnet konkret, ob es sich «lohnt», ihre Kunst voranzutreiben. Denn von etwas muss sie ja die Kita bezahlen. Gleichzeitig stellt sich die Frage: Woran soll ich dies messen? Nur am finanziellen Aspekt? Doch so einfach ist es nicht. Denn Künstlerin zu sein, ist eine Berufung, ein innerer Drang. Wie können Künstlerinnen also in unserem System sich selbst treu bleiben, weiterhin das in die Gesellschaft tragen, was in ihnen an Kunst geboren werden will, und trotzdem für ihr Kind da sein?
Ein vielfältiges Angebot an Kitas und Tagesbetreuungen reicht nicht. Wir sollten unsere Werte überdenken, die Rollenverteilung unter Eltern hinterfragen und anpassen. Warum ist Kinderbetreuung immer noch hauptsächlich Sache der Mutter? Wenn Mutter wie Vater ihren Teil der Familienarbeit übernehmen, könnten sie sich gegenseitig den Rücken stärken, und es kann gelingen, dass beide ihre Träume und ihre Berufung leben können.
Ein Privileg, das wir nutzen sollten
Wir leben in einem privilegierten Land, in dem sich viele diese Frage der Berufung leisten können und deshalb auch stellen sollten. Dies ist meines Erachtens unsere Verantwortung, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Letztendlich ist es unser persönlicher Entscheid, wie wir unser Leben leben. Aber es wäre schön, wenn wir versuchen, dies in einem Bereich zu tun, in dem wir uns selbst erkennen und in dem wir der Gesellschaft möglichst viel von uns zurückgeben können. Vielleicht eben als Mutter und Künstlerin.
Viel Spass bei der Erkundung deines Universums, wie du was bewertest und wieso du es genau so tust. Ob mit oder ohne Kunst.
Ich freue mich auf Weiteres. À la prochaine!



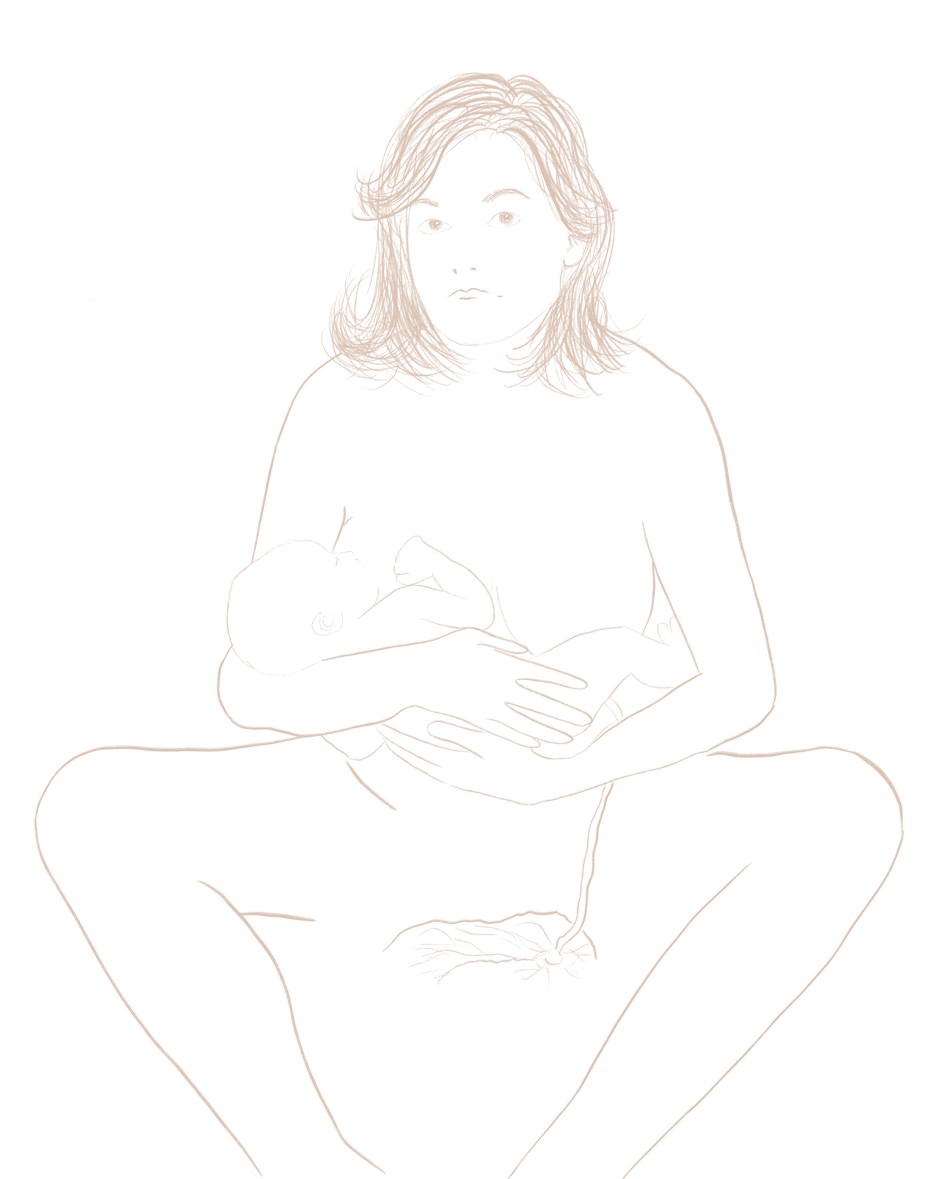
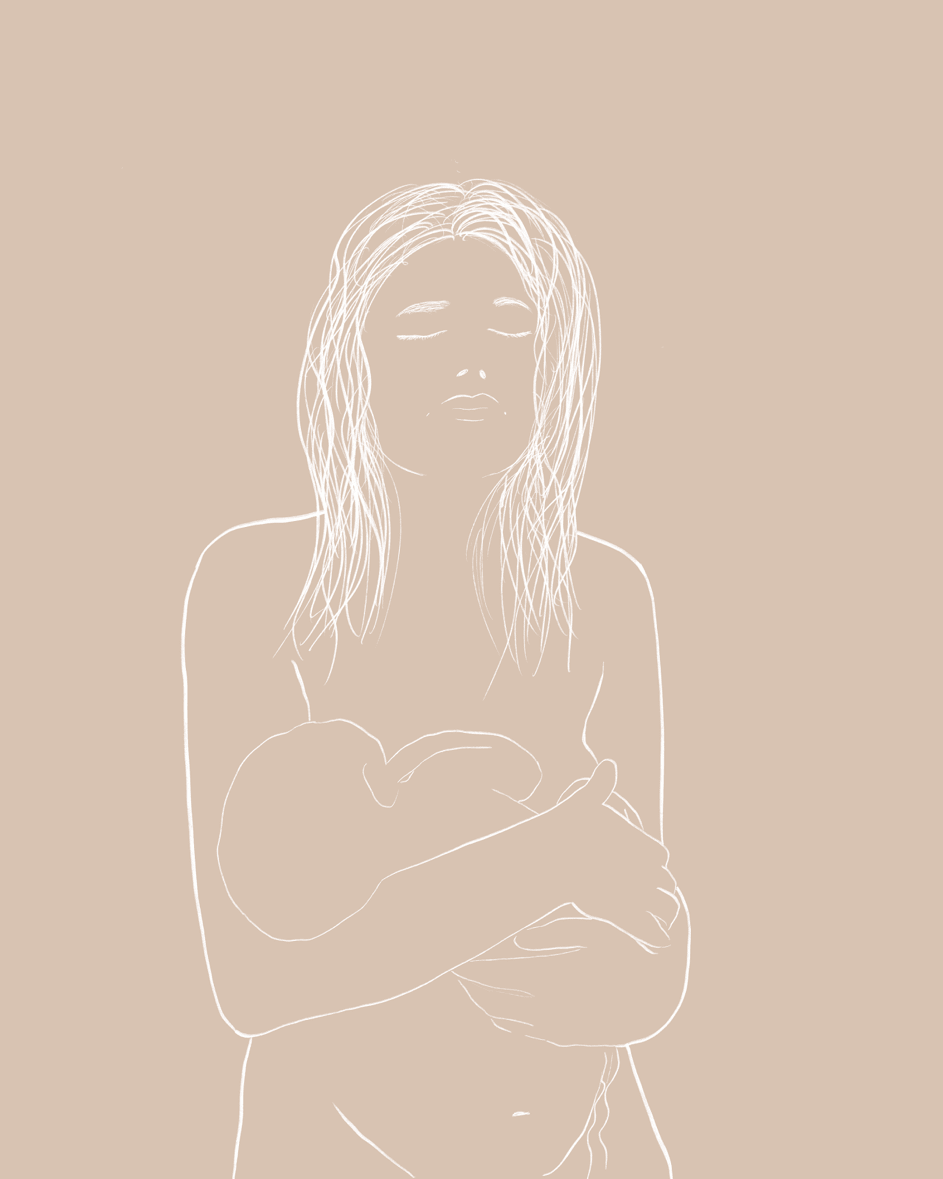

Mehr zu den Werken und ihren Künsterinnen erfährst du in der der elleXX-Galerie. Kuratorin Daniela Hediger stellt dort Perlen aus Kunst und Design vor. Die Werke kannst du nicht nur bestaunen, du kannst sie dir auch schenken: daniela.hediger@wom-art.com.




