Wirst du noch arbeiten? Wie viel denn? Rund fünf Jahre ist es her, da habe ich diese Fragen fast täglich gestellt bekommen. Ich war damals schwanger. Wie ich das Familienleben nach der Geburt organisieren würde, war für viele mindestens so interessant wie das Geschlecht des Babys. Ich rede bewusst von mir. Denn mein Partner – der zwar gleichermassen Vater wie ich Mutter wurde – bekam die Frage kaum zu hören.
Wir entschieden uns für die 60-80-Lösung. Ich leiste 60, er 80 Prozent Erwerbsarbeit. Inzwischen läuft unser System seit ungefähr vier Jahren. Auch mit zwei Kindern funktioniert es – mit den üblichen Herausforderungen – mehr oder weniger gut. Unsere Lösung ist in meinem Umfeld zum Klassiker geworden, und auch ausserhalb meiner urbanen Bubble ist diese Aufteilung breit akzeptiert. Bisher wertete ich das als gutes Zeichen. Erwerbstätige Mütter werden zur Norm, dachte ich. Dann erschien vor kurzem die Studie der Initiative Geschlechtergerechter zum Thema Teilzeitarbeit. Ihr Fazit: Eine Mehrheit der Bevölkerung (56 Prozent) findet, dass wir in der Schweiz mehr arbeiten müssten, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Eine noch grössere Mehrheit (68 Prozent) ist gleichzeitig der Meinung, wir würden schon zu viel arbeiten.
Wer soll denn konkret mehr Erwerbsarbeit leisten, um die Wirtschaft am Laufen zu halten? Hier sieht eine Mehrheit der Bevölkerung in erster Linie kinderlose Personen, die Teilzeit erwerbstätig sind, in der Pflicht. An zweiter Stelle folgen Eltern, die gar nicht arbeiten, auf Platz drei teilzeitarbeitende Väter und erst an letzter Stelle die teilzeitarbeitenden Mütter: Nur 31 Prozent der Bevölkerung wollen sie stärker in die Pflicht nehmen.
Nun kann man das positiv werten. Denn es ist natürlich fair und richtig, Mütter nicht unter Druck zu setzen. Es ist nicht an ihnen, auch noch das Problem des Fachkräftemangels zu lösen, zumal sie schon einen Grossteil der unbezahlten Care-Arbeit übernehmen. Das Ergebnis der Studie sagt aber auch: Mütter sollen sich in erster Linie weiterhin um die Familie kümmern. Die Erwerbsarbeit soll für sie eine Nebensache bleiben. So funktioniert unser System heute, und daran zu schrauben, scheint offenbar für viele keine Option zu sein.
Diverse Zahlen bestätigen diese Interpretation: Zwar sind in der Schweiz rund 82 Prozent der Mütter mit Kindern unter 15 Jahren erwerbstätig. Mehr als drei Viertel von ihnen arbeiten jedoch Teilzeit, rund ein Drittel in einem Erwerbspensum unter 50 Prozent. 68 Prozent der Bevölkerung denken zudem bei Teilzeitarbeit an Mütter; an Väter nur 19 Prozent. Und schliesslich findet eine Mehrheit der Bevölkerung, das ideale Erwerbspensum für Mütter liege bei 50 und für Väter bei 80 Prozent – und das am besten so lange, bis die Kinder ihre Schulzeit beenden. Das sind unter Umständen 20 Jahre. Das führt übrigens dazu, dass Mütter in der Realität im Schnitt rund 55 und Väter 91 Prozent ausser Haus arbeiten – auch wenn die Kinder erwachsen sind.
Dass die Gesellschaft von Müttern karrieremässig nicht viel erwartet, deckt sich mit meinen Erfahrungen. Auch mich fragt selten jemand nach meinen langfristigen beruflichen Zielen. Nicht mal ich selbst. Ich bin eine teilzeitarbeitende Mutter. Punkt.
Dass diese Überzeugungen so tief sitzen, hat Konsequenzen. Einerseits auf individueller Ebene: Unser System führt dazu, dass Frauen weniger Karriere machen als Männer, dadurch ein geringeres Einkommen haben und schliesslich auch bei der Altersvorsorge schlechter gestellt sind. In den Führungsetagen der Unternehmen sind Frauen – und vor allem Mütter – noch immer deutlich in der Unterzahl oder kaum vertreten. Nach der Geburt ihres ersten Kindes verdienen Frauen in der Schweiz rund 68 Prozent weniger, und das langfristig. Sie bekommen 35 Prozent weniger Rente und sind deutlich mehr von Altersarmut betroffen als Männer.
Andererseits bekommt die Wirtschaft die Absenz der Mütter mehr und mehr zu spüren. Der Fachkräftemangel ist schon heute ein Problem. Er wird sich in den nächsten Jahren weiter akzentuieren: Bis Ende 2025 könnten rund 365'000 Stellen unbesetzt bleiben. Bei den Müttern mit Teilzeitpensum schlummert also eigentlich ein grosses Potenzial. Um es besser auszuschöpfen, braucht es bessere Strukturen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss in der Schweiz verbessert werden. Diese Forderung ist nicht neu, die Massnahmen sind bekannt: Vaterschaftsurlaub, Elternzeit, mehr und bezahlbare Kita-Plätze, Individualbesteuerung, flexible Arbeitsmodelle. Wir diskutieren darüber seit Jahren. Und ja, es braucht diese strukturellen Veränderungen zwingend, damit sich etwas tut. Sie reichen aber nicht aus. Denn sich in der Diskussion um den Fachkräftemangel und die Karrieren von Müttern nur auf diese Rahmenbedingungen zu stützen, ist aus zwei Gründen problematisch.
Erstens: Die Schweiz tut sich enorm schwer mit Veränderungen. Wir haben es mit Ach und Krach geschafft zwei Wochen Vaterschaftsurlaub einzuführen – im Jahr 2021! Eine Elternzeit scheint noch in weiter Ferne. Die 38 Wochen, welche die Eidgenössische Kommission für Familienfragen vor kurzem aufs Tapet gebracht hat, löste heftige Diskussionen aus. Und erst vergangene Woche lehnte der Bundesrat einen Bundesbeitrag für die Senkung der Betreuungskosten für Familien ab. Bis sich die Strukturen also tatsächlich verändern, wird noch viel Zeit ins Land gehen.
Zweitens: Es reicht nicht aus, nur an diesen Strukturen zu arbeiten. Klar, sie sind wichtige Pfeiler, wenn es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht. Mindestens so wichtig ist aber, dass wir endlich ernsthaft über unbezahlte Care-Arbeit reden. Denn Mütter arbeiten nicht nur Teilzeit, weil es zu wenig Kita-Plätze gibt oder ihr Einkommen für die Steuern draufgeht. Sie tun dies auch, weil sie neben der Erwerbsarbeit viele Aufgaben übernehmen die weder bezahlt noch in der Öffentlichkeit sichtbar sind: die Kinderbetreuung, Erziehung, Hausarbeiten, Einspringen, wenn ein Kind krank ist, Kinder zu ihren Freizeitaktivitäten begleiten, Arzttermine wahrnehmen, Schulbesuche, Geburtstagspartys oder -geschenke organisieren, Familienangehörige betreuen oder pflegen und, und, und.
All diese Aufgaben brauchen Zeit und Energie. Nicht immer will oder kann man sie extern auslagern. Vor allem dann nicht, wenn die finanziellen Mittel begrenzt sind. Gleichzeitig werden diese Tätigkeiten in der öffentlichen Debatte ausgeblendet oder im besten Fall marginalisiert und als banale Kleinigkeiten abgestempelt. Doch wer sich solchen Aufgaben widmet, weiss, dass ihre Erledigung alles andere als eine Kleinigkeit ist. Für die Zweifler:innen hier ein paar Zahlen: 9,2 Milliarden Stunden unbezahlte Haus- und Familienarbeit werden jährlich in der Schweiz geleistet. Frauen übernehmen davon 60,5 Prozent. Pro Woche investieren sie also im Schnitt 28,7 Stunden in die Kinderbetreuung, ins Kochen, Einkaufen und Waschen, während Männer 19,1 Stunden dafür aufwenden. Der Wert der Gratisarbeit von Frauen beläuft sich insgesamt auf 241 Milliarden Franken. Trotzdem sind wir von finanzieller und gesellschaftlicher Wertschätzung und Anerkennung für diese Arbeit noch immer weit entfernt.
Wenn Mütter also der Wirtschaft zu Hilfe eilen und ihre Erwerbsarbeitspensen weiter erhöhen sollen, dann muss sich mehr ändern als die Strukturen. Mütter müssen ihr unbezahltes Care-Arbeits-Pensums reduzieren können. Wir brauchen einen ernsthaften Dialog über unbezahlte Care-Arbeit, an dem sich die Wirtschaft, die Politik und vor allem die Männer beteiligen und Verpflichtungen eingehen: Erstens müssen wir unbezahlte Care-Arbeit sichtbar machen und die Aufgaben benennen. Zweitens muss sie als Arbeit anerkannt werden. Und drittens müssen Politik und Wirtschaft dafür sorgen, dass Zeit und finanzielle Ressourcen für diese Arbeit zur Verfügung stehen. Stichwort Care-Lohn, Senkungen der Wochenarbeitsstunden, Viertagewoche, Top-Sharing, flexible Arbeitszeiten und so weiter.
Viele dieser Themen stehen schon im Raum: 68 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz würden gerne weniger arbeiten. Eine Mehrheit findet, dass Kita-Plätze vermehrt subventioniert werden und auch Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen, Geld erhalten sollen. Die Viertagewoche begrüssen zwei Drittel der Bevölkerung.
Der Fachkräftemangel wird uns zu Veränderungen zwingen. Nutzen wir diese Chance. Überdenken wir unser System ganzheitlich.

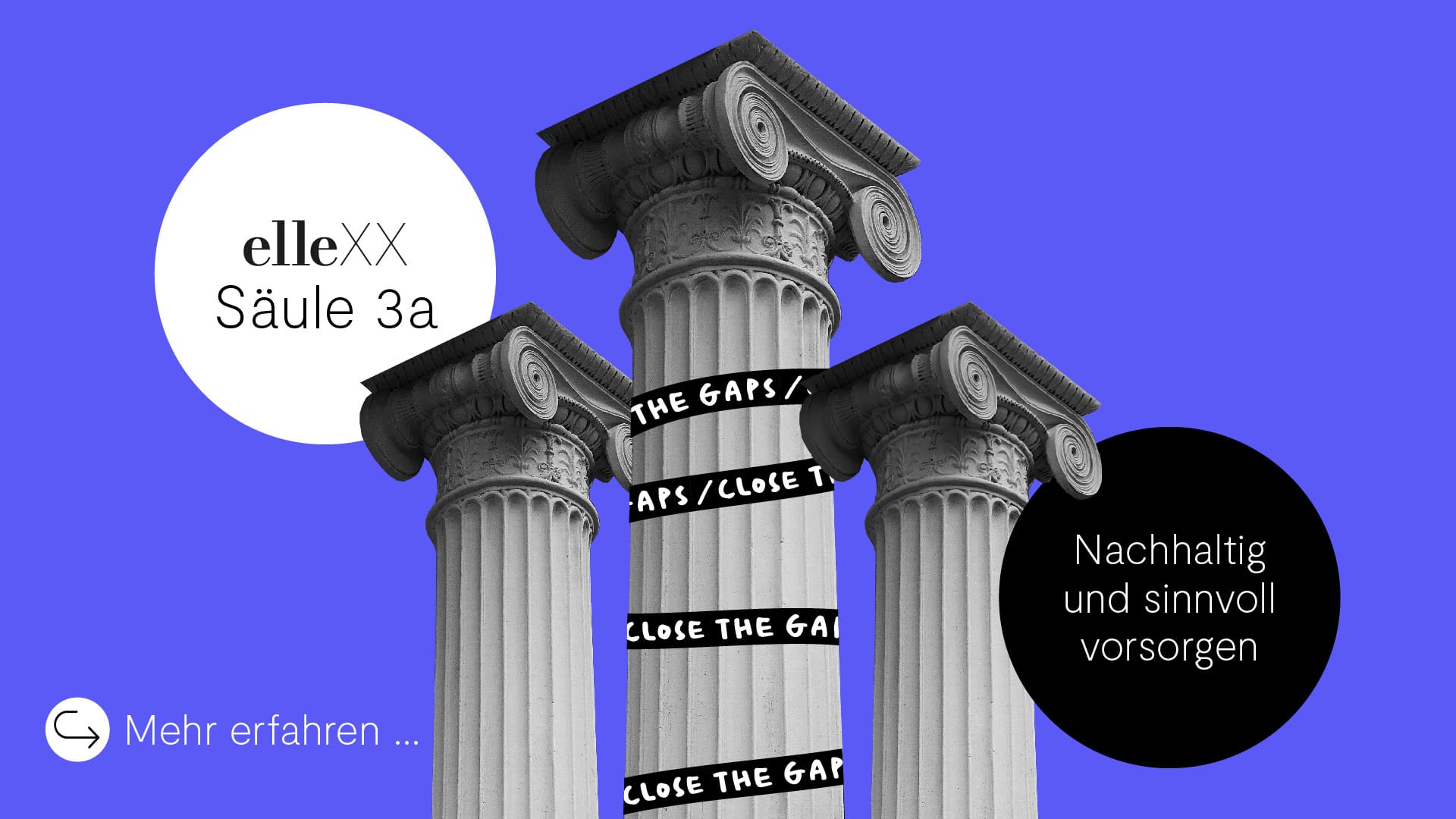
.jpg-.jpg)



