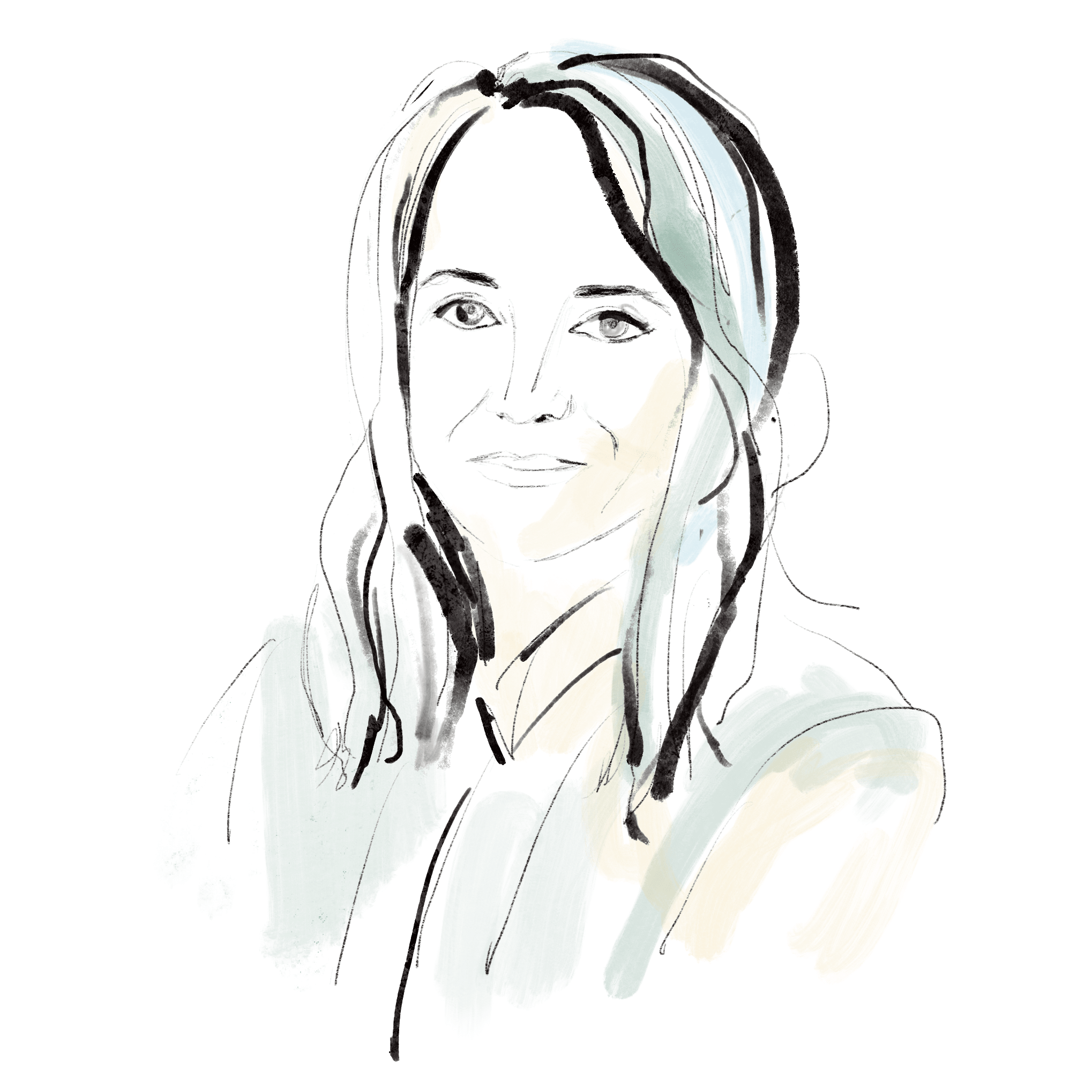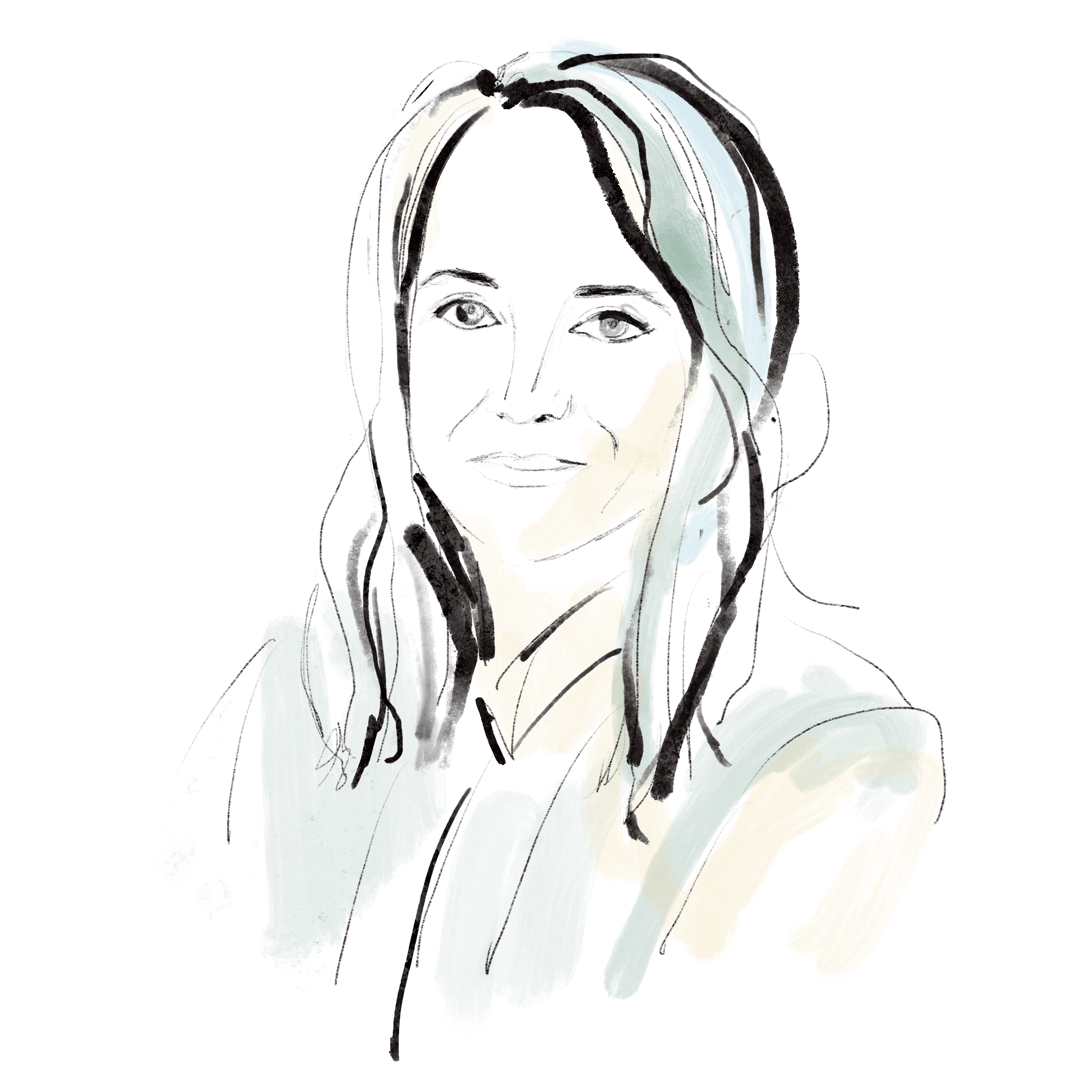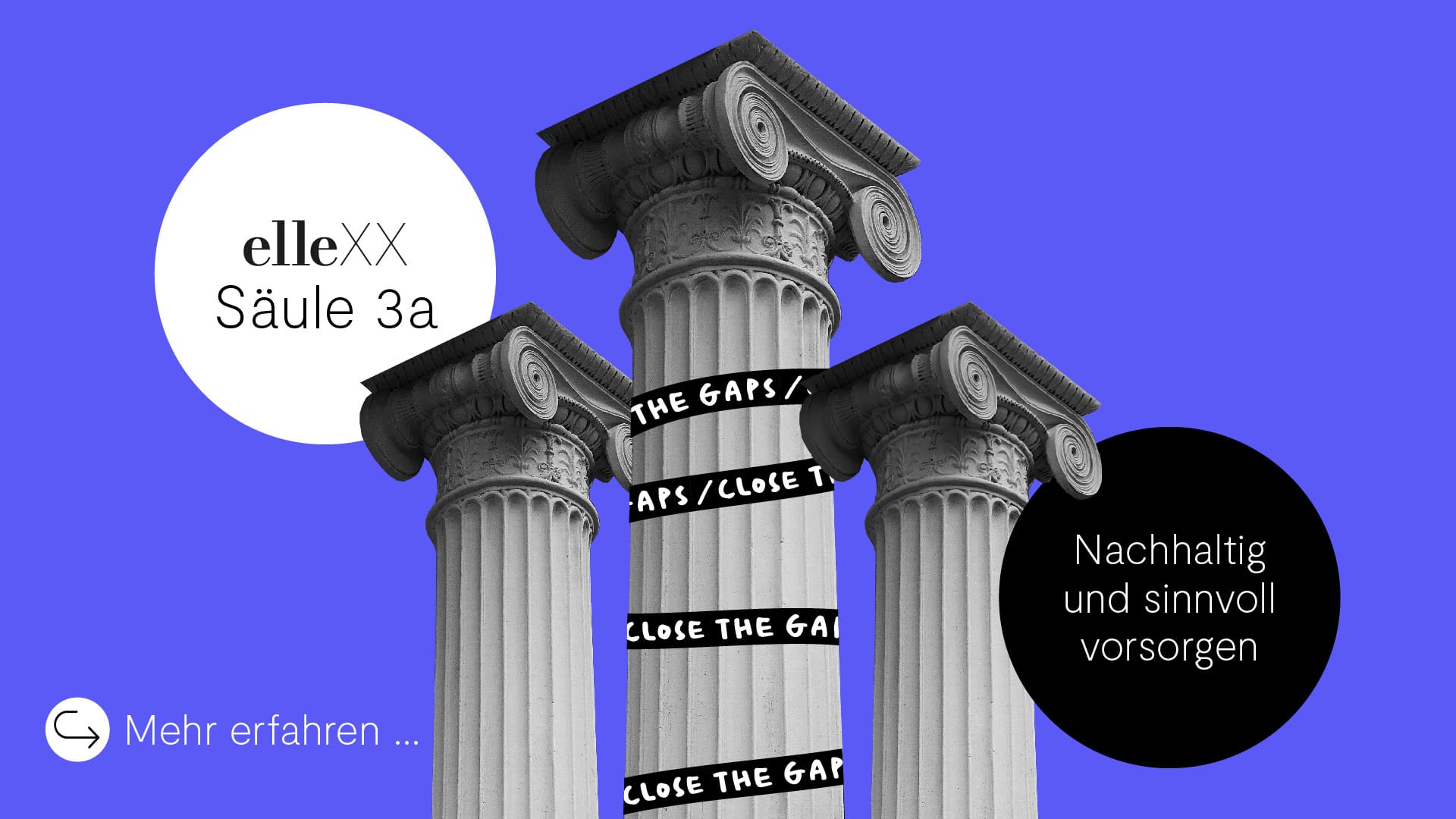Sexualisierte Gewalt ist in der Schweiz weit verbreitet. Rund 20 Prozent der Frauen sind in ihrem Leben mindestens einmal davon betroffen. Angezeigt werden solche Fälle höchst selten: Nur zehn Prozent der Betroffenen melden sich bei der Polizei, Strafanzeige erstatten gar nur acht Prozent. Zu Verurteilungen kommt es kaum. Warum ist das so? Welche Rolle spielt dabei der Umgang mit sexualisierter Gewalt bei der Polizei und im Justizsystem? Diesen Fragen sind Miriam Suter, stellvertretende Chefredaktorin bei elleXX, und Natalia Widla, freischaffende Journalistin, für ihr Buch «Hast du Nein gesagt?» nachgegangen. Sie begleiteten Betroffene von der ersten Einvernahme bis in den Gerichtssaal, sprachen mit Polizist:innen, durchleuchteten die polizeiliche Ausbildung und interviewten Expert:innen zur aktuellen Praxis in der Schweiz. Mit uns haben die beiden Autorinnen über ihr Buch gesprochen und darüber, was sich in der Schweiz im Umgang mit sexualisierter Gewalt ändern muss.
Was war der Auslöser für dieses Buch?
Miriam: Erlebnisse von Freundinnen mit der Polizei, wenn sie zum Beispiel Übergriffe gemeldet haben. Und meine eigenen Erfahrungen als Journalistin, wenn ich mit Pressesprechern der Polizei zu tun hatte und mich erkundigte, wie man mit solchen Themen umgeht. Ich habe mich irgendwann gefragt: Was ist da eigentlich los bei der Polizei? Vor etwa zwei Jahren habe ich dann zusammen mit einer Kollegin eine Reportage über dieses Thema für das Onlinemagazin Republik geschrieben. Danach wusste ich: Das Thema ist so riesig – eine Reportage allein kann die strukturellen Probleme nicht genug auffangen. Ich wollte ein Buch darüber schreiben, aber nicht alleine. Deshalb habe ich Natalia angefragt, die eine hervorragende Journalistin ist.
Natalia: Auch ich habe bereits einiges zum Thema sexualisierte Gewalt geschrieben. Ich hatte bisher jedoch weder die Zeit noch die Ressourcen, mich in einer adäquaten Tiefe mit den strukturellen Problemen und deren Verknüpfungen zu beschäftigen. Als ich für eine Opferberatungsstelle einen Jahresbericht schrieb, wurde mir zudem bewusst: Wenn ich von sexualisierter Gewalt betroffen wäre, würde ich nur durch Zufall zu einer Opferhilfestelle gelangen, weil ich von deren Existenz gar nichts wusste. Das ist eine Schande! Miriams Anfrage hat also gut gepasst.
Ihr konzentriert euch auf drei Institutionen im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt: Die Polizei, die Opferberatungsstellen und die Justiz. Warum legt ihr den Fokus darauf?
Miriam: Weil das die ersten drei Anlaufstellen für Opfer von sexualisierter Gewalt sind. Wir wollten aufzeigen, dass es schon an diesen Stellen Dinge gibt, die schief laufen. Zum Beispiel die vielerorts fehlende Sensibilisierung der Polizei im Umgang mit Opfern von sexualisierter Gewalt; die Unterfinanzierung und der Personalmangel bei den Opferhilfestellen und das Sexualstraftrecht, das viele Lücken hat. Und wir wollten zeigen, wie diese drei Institutionen zusammenhängen. Man kann sich das wie ein Netz vorstellen: Was im Sexualstrafrecht steht, hat einen grossen Einfluss auf die polizeiliche Einvernahme. Die Ressourcenknappheit bei den Opferberatungsstellen hat wiederum einen direkten Einfluss auf die Betroffenen.
Natalia: Die Zahlen zu sexueller Gewalt sind bekannt: Nur wenige Fälle werden überhaupt erst zur Anzeige gebracht, und bis es zu einer Verurteilung kommt, befinden wir uns im tiefen einstelligen Prozentbereich. Manche Einzelfälle werden zwar in den Massenmedien breit diskutiert. Aber warum die Strukturen dazu führen, dass so wenig Frauen eine Anzeige machen, weshalb es so wenige Verurteilungen gibt, darauf findet man kaum je eine wirklich zufriedenstellende Antwort. Auch wir haben diese Antwort nicht abschliessend gefunden. Unser Fokus liegt auf dem Weg der Opfer nach der Tat, ohne das Augenmerk auf die Gewalt per se zu legen. Das Buch zeigt, wie anstrengend dieser Weg ist, und erklärt vielleicht zu einem Teil, weshalb ihn nicht jede gehen oder durchhalten kann – verständlicherweise.
Welcher der drei Pfeiler ist eurer Meinung vor allem dafür verantwortlich, dass der Weg für die Opfer so anstrengend ist?
Miriam: Die Polizei als Institution nimmt eine zentrale Rolle ein. In der Schweiz geht man zur Polizei, wenn einem etwas passiert und man Gerechtigkeit will. Wie gesagt, eigentlich war das auch unsere Leitfrage für dieses Buch: Was ist bei der Polizei eigentlich los? Wie kann es sein, dass Betroffene da teilweise so schlimme Dinge erleben? Aber uns wurde durch das Buch bewusst, wie sehr diese drei Institutionen zusammenhängen: Das Sexualstrafrecht beeinflusst wie gesagt die Art der Einvernahmen bei der Polizei – Polizist:innen müssen ja umsetzen, was im Gesetz steht. Ein weiterer wichtiger Punkt: Vielen Opfern fehlt das Wissen über Opferberatungsstellen. Oder sie wollen da nicht hin, weil das Wort Opfer abschreckend wirkt. Hier spielt also auch das gesellschaftliche und politische Klima eine Rolle.
Ist euer Fazit nach dem Buch, dass es bei der Polizei die grössten Probleme im Umgang mit sexualisierter Gewalt gibt?
Natalia: Ich sehe das grösste Problem beim Zusammenspiel von Judikative und Exekutive. Die Polizei setzt die geltenden Gesetze um. Und bei allen Gesetzen gibt es einen gewissen Spielraum. Es gibt Polizist:innen, die diesen Spielraum zugunsten der Opfer nutzen. Aber auch bei der Polizeiarbeit fliesst immer eine menschliche Komponente mit ein – also zum Beispiel im Umgang mit den Opfern oder in Bezug auf Vorurteile. Gleichzeitig ist das Unbefriedigende an unserem Buch, dass wir das Problem bei der Polizei nicht ganz konkret benennen konnten. Wir haben versucht, uns heranzutasten, indem wir zum Beispiel die Ausbildung angeschaut und den Polizei-Unterricht besucht haben.
Was habt ihr da festgestellt?
Natalia: Der Unterricht war vielleicht in Sachen Wokeness nicht auf dem allerneuesten Stand, aber er war alles andere als schlecht. Am Ende kamen wir immer wieder zum Schluss: Das Problem bei der Polizeiarbeit und ihrem Umgang mit Opfern von sexualisierter Gewalt ist die Cop-Culture, der Korpsgeist, die Blue Wall des Schweigens, wenn Fehler passieren. Diese Punkte müsste man weiter aufdröseln und sich fragen: Was hat dieses Verhalten der Polizei mit der Gesellschaft als Ganzes zu tun? Was hat es mit der persönlichen Prädisposition für den Beruf zu tun? Das können wir nicht beantworten – wir sind ja keine Soziologinnen.
Miriam: In diesem Zusammenhang muss man sich in Erinnerung rufen, wie Opferberatungsstellen und Polizei entstanden sind. Opferberatungsstellen sind aus einer feministischen Bewegung heraus entstanden – und die Polizei quasi aus dem Gegenteil. Diese Geschichte beeinflusst die Arbeit dieser Institutionen. Gerade bei sexualisierter Gewalt finde ich es wichtig, dass die Institution jeweils auf der Seite der Opfer steht. Und das war bei der Polizei oft nicht der Fall, wie wir bei unserer Recherche gemerkt haben. Es gibt sehr viele gesellschaftliche Vorurteile gegenüber Opfern von sexueller Gewalt, und diese Vorurteile sind leider auch bei der Polizei präsent.
Welches sind die häufigsten Vorurteile gegenüber Opfern?
Miriam: Ein grosses Problem ist das sogenannte Victim Blaming – also die Frage nach der Schuld der Opfer – von der Gesellschaft und von den Betroffenen selbst. Was hast du gemacht? Hast du provoziert? Was hast du getan oder eben nicht getan, um die Tat zu verhindern? Weshalb hast du dich nicht besser geschützt? Diese Fragen müssen Opfer bei den Einvernahmen und im weiteren Verfahren wieder und wieder beantworten. Deshalb ist auch der Titel unseres Buches: Hast du Nein gesagt? Diese Fragen müssen gestellt werden, weil das Sexualstrafrecht heute stark darauf fokussiert, dass Opfer sich verteidigen müssen. Das führt unter anderem zu einer gigantischen Scham bei vielen Betroffenen. Sie denken: Wenn ich mich mehr gewehrt hätte, wäre mir das nicht passiert. Dabei ist das ein Irrglaube!
Natalia: Bei der Polizei und Justiz gibt es gegenüber den Opfern noch andere Vorurteile. Zum Beispiel die Annahme, dass Kinder, die Gewalt erlebt haben, solche Taten im Erwachsenenleben anziehen oder sich diese gar einbilden. Das ist uns in zwei Prozessen begegnet. In einem Fall wurde dem Opfer bei der Erstbefragung unterstellt, sie habe sich den Übergriff eingebildet. Beim anderen Fall wurde der Frau gesagt, sie reagiere überempfindlich auf das Thema, und sie würde eine normale sexuelle Handlung als Gewalt auslegen, weil sie als Kind schon sexuelle Gewalt erlebt hat. Das ist absolut widerlich.
Gibt es auch Vorurteile gegenüber der Täterschaft?
Miriam: Ja. Sicherlich eines der am meisten verbreiteten Klischees ist das Bild vom fremden Mann, der nachts im Park eine Frau überfällt. In über 80 Prozent der Fälle kennen die Opfer die Täter aber bereits vor der Tat. Das macht es für die Betroffenen oft schwierig, Anzeige zu erstatten. Sie trauen sich vielleicht nicht, weil sie die Person einmal gerne hatten oder ihr keine Probleme machen wollen. Ein weiterer Mythos, den Agota Lavoyer in unserem Buch beschreibt, ist dieses Bild vom Mann, der sich aus Lust nicht zurückhalten kann. Eine Vergewaltigung hat in den seltensten Fällen etwas mit sexueller Lust zu tun. In dem Moment, in dem man sich über den Willen einer anderen Person hinwegsetzt, ist das nicht Lust, sondern Gewalt.
Natalia: Dann gibt es auch rassifizierte und klassenbezogene Vorurteile. Wenn der Täter ein weisser, studierter Zürcher aus der Mittelklasse ist, geht die Justiz anders an den Fall heran, als wenn der Täter eine «person of colour» ist oder einen Migrationshintergrund hat. Das ist keine neue Erkenntnis, aber wir konnten das am Rande bestätigen.
Der gesamte Einvernahme-Prozess bei der Polizei und Justiz ist für Opfer sehr anstrengend. Weshalb?
Miriam: Sehr belastend ist grundsätzlich, dass die Opfer die Tat mehrmals mit allen Details beschreiben müssen. Das erste Mal bei der ersten Einvernahme. Diese ist die wichtigste, weil sie den Grundstein für den folgenden Prozess legt. Sie kann bis zu acht Stunden oder länger dauern und findet, je nachdem, relativ kurz nach der Tat statt. Das Opfer befindet sich also vielleicht noch immer im Schockzustand, wenn es vernommen wird. Ein:e Polizist:in tippt das Gespräch Wort für Wort mit. Es kann auch vorkommen, dass die Interviews aufgezeichnet werden; bei den Frauen, mit denen wir gesprochen haben, war das aber nie der Fall. Auch die Opferberaterinnen bestätigen, dass nur selten aufgezeichnet wird. Damit die oder der Polizist:in mitschreiben kann, musst du also langsam sprechen und immer wieder Pausen machen. Das macht das Gespräch unfassbar anstrengend. Und leider wird das Verhalten der Betroffenen während dieser Einvernahme später oft negativ ausgelegt: «Du konntest nicht stringent erzählen, du lügst.» «Du weinst nicht (weil du dich so konzentrieren musstest), du lügst.»
Natalia: Ein Problem sind, wie bereits erwähnt, auch die Fragen, die dem Opfer gestellt werden: «Warum hast du nicht nein gesagt?» «Was hattest du an dem Abend an?» «Wie viel hast du getrunken?» Dabei sind nicht die Fragen per se problematisch. Sie sind wichtig, um Stringenz herzustellen. Das Problem ist, dass diese Fragen nicht kontextualisiert werden. Den Betroffenen wird nicht erklärt, warum diese Fragen gestellt werden müssen. So entsteht bei ihnen das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen oder schuld an der Tat zu sein.
Miriam: Dazu kommt das Setting dieser Einvernahmen: Die Räume sind meistens karg, die Stühle unbequem. Den Frauen wird oft nicht einmal Wasser oder ein Snack angeboten. Und das, obwohl sie mehrere Stunden lang erzählen müssen – das ist körperlich enorm anstrengend. Die Einvernahmen sind auf allen Ebenen unangenehm, und dass sie oft nicht angenehmer gestaltet werden, zeigt, welchen Wert man den Opfern in diesem Moment gibt. Hierzu muss man aber sagen: Es gibt Kantone, die dem einen grösseren Wert beimessen und diese Räume etwas gemütlicher gestalten, St. Gallen zum Beispiel.
Welche Folgen hat all das für die Opfer?
Natalia: Solche negativen Erlebnisse machen die Runde, vor allem bei Leuten, die sowieso schon einen schlechteren Zugang zur Polizei haben. Dann überlegst du dir einfach doppelt, ob du eine Anzeige machen und den Prozess durchgehen willst. Viele verzichten. Ein Prozess ist aber die einzige Möglichkeit, um Täter von der Strasse zu holen.
Miriam: Wenn die Betroffenen schon bei der ersten Einvernahme so retraumatisierende Erlebnisse machen, brechen sie den Prozess vielleicht ab. Dann kommt es nicht einmal zu einer Anzeige, geschweige denn zu einer Verurteilung. Eine Betroffene aus dem Buch hat uns gesagt: «Wenn mir nochmals so etwas passiert, dann würde ich nicht mehr zur Polizei gehen.» Selbst Polizistinnen haben uns gesagt, sie würden nicht zur Polizei gehen, wenn ihnen so etwas passiert. Diese Aussagen sind schon heavy, finde ich.
Was müsste sich denn ändern?
Miriam: Es fehlt vielerorts so viel entsprechendes Wissen bei der Polizei und Justiz. Dabei wären diese Fragen so wichtig: Was passiert mit einem Menschen, wenn er oder sie ein traumatisierendes Erlebnis nochmals schildern muss? Wie verhält sich eine Person in solchen Situationen? Hier braucht es viel mehr Sensibilisierung, und zwar bereits in der Grundausbildung.
Natalia: Es wären eigentlich auch schon viele Mittel da, aber sie werden nicht ausreichend genutzt. Beispielsweise gibt es die sogenannten prozessualen Opferrechte. Dazu gehört, dass man eine zweite Person zur Einvernahme mitnehmen darf. Polizist:innen klären Opfer darüber oft nicht auf. Doch genau solche kleinen Dinge könnten den Unterschied machen. Wenn dein Freund, deine Mutter oder deine Kollegin dabei ist und deine Hand hält, traust du dich vielleicht eher, zu erzählen. Wenn diese Aufklärung versäumt und die Leute nicht auf ihre in der Verfassung garantierten Rechte hingewiesen werden, dann wird sich die Statistik nicht ändern.
Nächste Woche diskutiert der Ständerat zum zweiten Mal die «Nur Ja heisst Ja»-Lösung für das Sexualstrafrecht in der Schweiz. Was würde sich mit einer solchen Lösung ganz konkret ändern?
Miriam: Das können wir nur theoretisch abschätzen. Aber praktisch alle Fachpersonen, die mit Betroffenen arbeiten, sagen, es würde vieles und Grundsätzliches ändern. Beispielsweise den Fragenkatalog bei der Einvernahme. Die Chance ist hoch, dass man nicht mehr gefragt wird: «Hast du Nein gesagt?» Sondern es wird vielleicht die Tatperson gefragt: «Wie hast du gemerkt, dass dein Gegenüber eingewilligt hat?» Durch eine solche gesetzliche Änderung könnte der Fokus mehr auf die Tatperson gelegt werden. Sie muss sich Gedanken machen: «Wie konnte ich davon ausgehen, dass die andere Person das will?»
Natalia: Ich persönlich bin nicht so positiv eingestellt, dass sich in der Praxis etwas ändern würde. Es gibt Erkenntnisse aus Ländern, die ein solches Gesetz schon haben. Es führt nicht zwingend zu mehr Verurteilungen und Prozessen. Trotzdem sollten wir diese Lösung fordern, weil sie ein Signal an die Betroffenen sendet und es wichtig für die Heilung und das Selbstverständnis der Opfer ist. Das muss als Argumentationsbasis reichen. Aber wir müssen auch realistisch sein. An der Beweislast wird sich nicht wirklich etwas ändern. Ein Täter kann vor Gericht immer sagen: «Sie hat ja gesagt.»
Miriam: Tamara Funiciello erklärt das in ihrem Interview im Buch sehr gut: Wir müssen uns die Grundsatzfrage stellen, wie wir Sex und Konsens im juristischen Rahmen definieren wollen. Wer muss einen Körper schützen? Muss ich sagen: «Nein, ich will das nicht?» Oder muss die andere Person fragen: «Darf ich das machen?» Das sind riesige Unterschiede, auch wenn gewisse Abläufe in der Realität noch immer gleich sein werden.
Was braucht es sonst noch?
Miriam: Viel. Vor allem aber braucht es noch ganz viel Sensibilisierungsarbeit auf allen Ebenen. Und deshalb mehr finanzielle Ressourcen im Kampf gegen Gewalt an Frauen. Diesbezüglich ist die Schweiz in einer Loser-Position.
Du sprichst die Istanbul-Konvention an, der die Schweiz 2017 beigetreten und die seit 2018 in Kraft ist. Damit verpflichtet sie sich, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen.
Miriam: Genau. Jedes Jahr wird die Schweiz gerügt in Bezug auf die Umsetzung der Istanbul Konventionen, jedes Jahr sagen mehrere unabhängige Gremien, dass wir zu wenig investieren und dem nicht gerecht werden, wozu wir uns vor Jahren verpflichtet haben.
Natalia: Eine ganz konkrete Massnahme wäre die bessere Finanzierung der Opferhilfen und deren Vereinheitlichung. In der Stadt Zürich sind wir in einer Luxus-Situation, da gibt es für alles eine spezialisierte Stelle. Aber es wäre wichtig, dass es schweizweit Opferberatungsstellen gibt, die 24 Stunden an 365 Tagen erreichbar sind. Und die Leute müssen informiert werden, dass es diese Stellen gibt. Wenn sich jemand in einer Gemeinde anmeldet, dann könnte man ihnen zum Beispiel einen Infozettel über kantonale Opferhilfestellen zuschicken.
Miriam: Es geht alles auf die Frage zurück: Wie geht die Schweiz mit Gewalt an Frauen um? In der Schweiz wird diesbezüglich viel zu viel privatisiert.
Natalia: Genau: Was zu Hause passiert, bleibt zu Hause. Diese Einstellung zieht sich durch in Bezug auf jegliche Formen häuslicher Gewalt. Das ist ein Problem, insbesondere wenn man bedenkt, dass 80 Prozent der Täter die Opfer kennen. Bis 2004 waren Vergewaltigungen in der Ehe noch ein Antragsdelikt, vor 1992 gar nicht erst strafrechtlich relevant. Es ist einfach eine unendliche langsame Entwicklung aus diesem Mindset der Privatisierung. Gewalt an Frauen darf einfach keine Privatsache mehr sein.
Wie ging es euch persönlich während dem Schreibprozess?
Natalia: Es war sehr streng. Wir haben uns oft ausgetauscht und manchmal richtiggehend ausgekotzt. Vor allem war viel Frust da, weil diverse Stellen abblockten. Auch die Prozesse waren heftig. Ich möchte nicht so bald wieder mit einem Vergewaltiger im Gerichtssaal sitzen.
Miriam: Es war ein heftiges Auf und Ab für mich. Es gab Momente, da wurde mir bewusst, wie schlimm das alles ist. Dann wusste ich aber auch, wie wichtig dieses Buch ist. Und es gab Momente, da wollte ich fast lachen, aus Frust, weil es so absurd ist, was da abgeht. Ich habe aber natürlich auch viel geweint. Da konnten wir uns gegenseitig gut auffangen – und das war das Schöne an diesem gemeinsamen Schreibprozess.
Wie lässt euch das Buch zurück?
Natalia: Ich glaube leider nicht, dass sich bald etwas ändern wird.
Miriam: Der grosse nationale Frauenstreik hat viel ausgelöst. Viel mehr Leute sind heute politisch, mehr Frauen wollen und gehen in die Politik – das ist super. Und gleichzeitig gibt es weltweit einen krassen konservativen Backlash. Wir sind jetzt in einem Moment der Extreme. Ich empfand die Arbeit am Buch auch aus diesen Gründen bestärkend und frustrierend zugleich. Und diese seltsame Gleichzeitigkeit finde ich noch immer schwierig auszuhalten.
Das Buch «Hast du nein gesagt?» kannst du ab sofort hier oder in deinem Lieblingsbuchladen bestellen. Die Daten für Lesungen findest du hier.