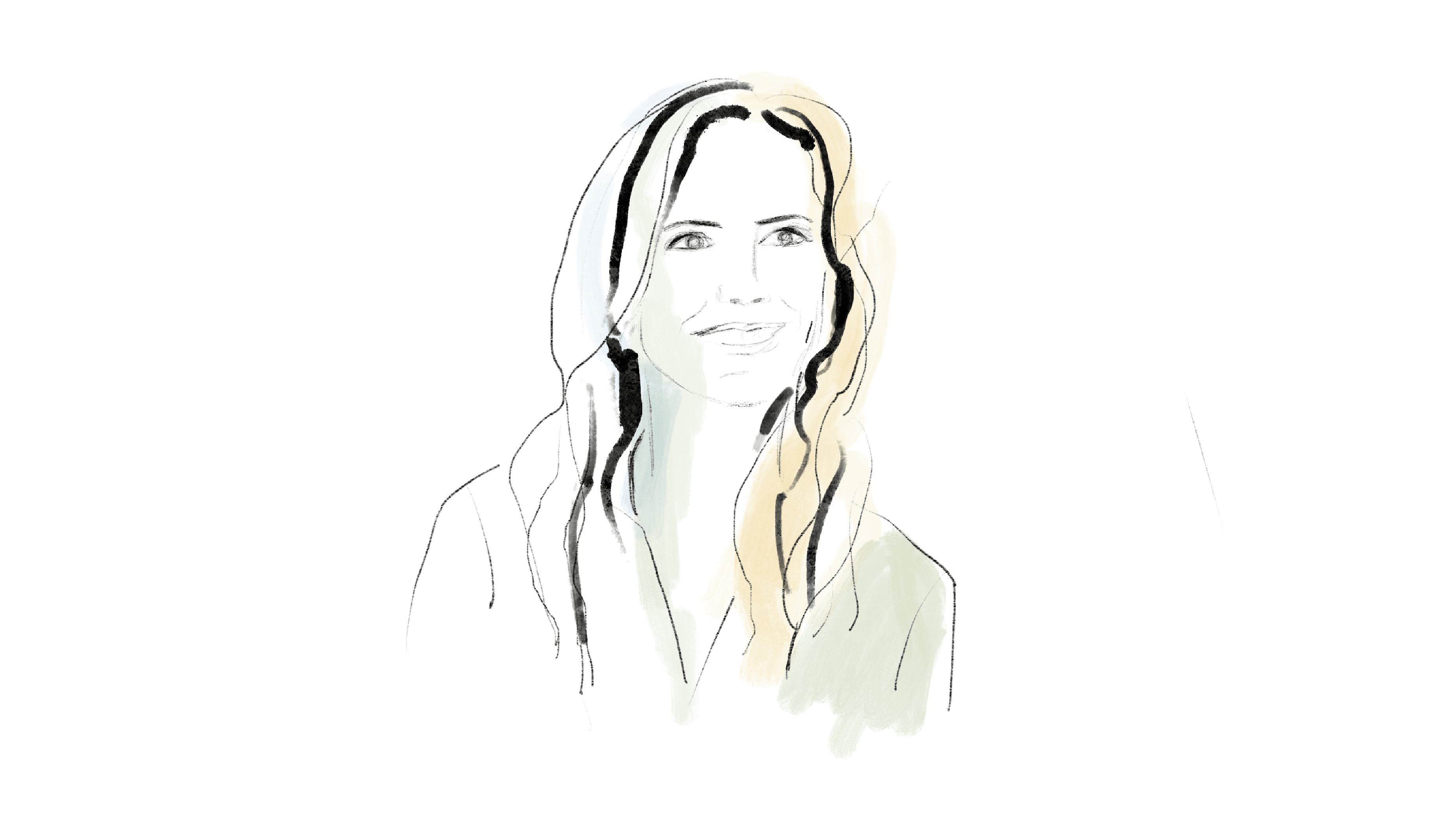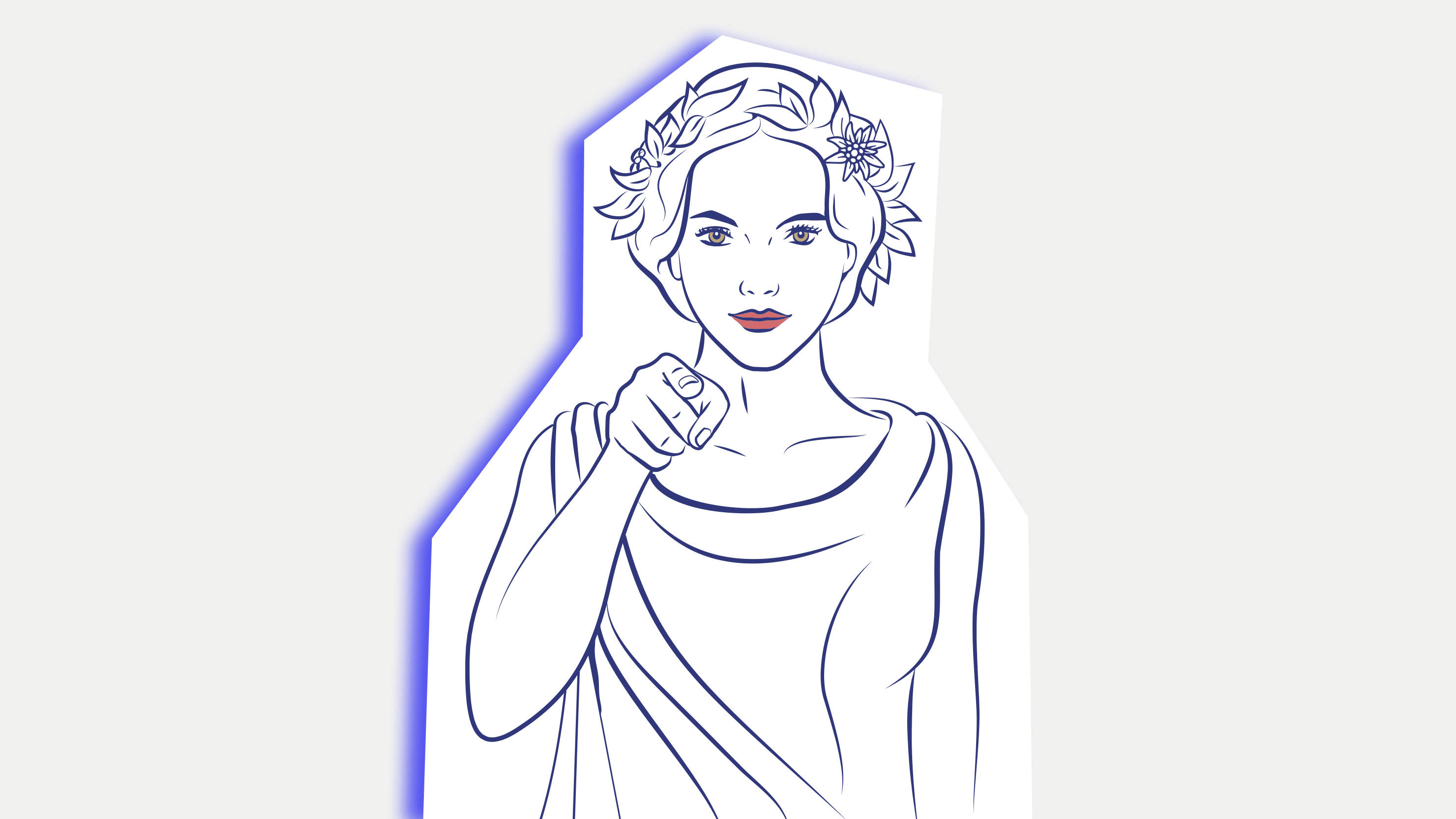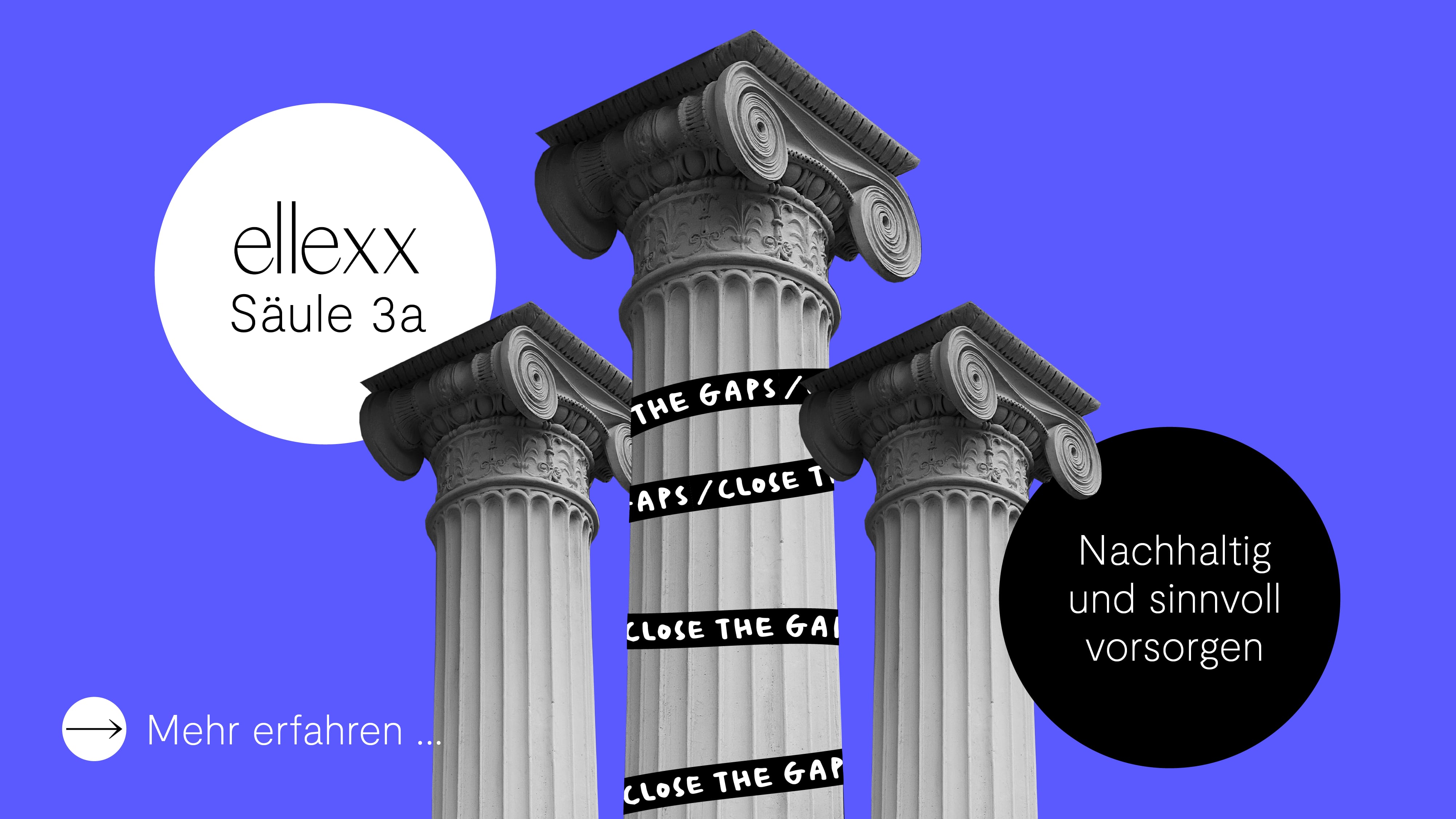«Ist Ihr Kind eine Belastung für Sie?», fragte mich kürzlich jemand, nachdem ich in einem Panel über unsere Familiensituation gesprochen hatte. Ich musste kurz durchatmen, weil mich solche Fragen immer irritieren und eine mögliche Schuld suggerieren. Ich antwortete: «Es ist nicht mein Kind, das belastet, es sind die Hürden, die uns in den Weg gelegt werden. Zum Beispiel die viele Bürokratie und die finanzielle Belastung.»
Was ich damit meine? Braucht meine Tochter ein neues Spezialvelo, eine neue Therapie, zusätzliche Betreuung oder besondere ärztliche Behandlung, bedeutet das oft mehrtägigen Aufwand. In einem ersten Schritt muss ich das richtige Formular finden und die Behördensprache verstehen, damit ich weiss, was zu tun ist. Dann gilt es, die richtigen Worte für den Brief zu formulieren, Berichte zu kopieren und einzuscannen, alle Ausweise und Nummern zusammenzusuchen. Dann folgt meist zuerst eine Ablehnung der Kostenübernahme. Daraufhin mache ich einen Rekurs, unter Umständen auch mehrere, und irgendwann werden im besten Fall Kosten übernommen, oft aber auch abgelehnt. Dann geht dasselbe Spiel von vorne los: Ich schreibe Stiftungen an und hoffe auf finanzielle Unterstützung ihrerseits.
Das Sozial- und Gesundheitssystem in der Schweiz erinnert mich immer wieder an das Sprichwort, das mein Lehrer mir schon in der Primarschule einprägte: Von nichts kommt nichts. In Bezug auf pflegende Familien müsste es jedoch ehrlicherweise heissen: Von sehr viel kommt oft gar nichts. Trotz grosser Bemühungen, trotz täglicher unermüdlicher Care-Arbeit, erhalten viele Familien mit kranken oder behinderten Kindern kaum Unterstützung, es werden gar lebenswichtige Abklärungen und Behandlungen verzögert.
Ein Beispiel: Nachdem meine Tochter sämtliche Entwicklungsabklärungen durchlaufen hatte, wurde uns eine genetische Abklärung empfohlen. Vor allem, um allfällige Erkrankungen im Zusammenhang mit dem möglichen Gendefekt frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Die Kostenübernahme der Abklärung – mehrere tausend Franken – wurde bei der Krankenkasse aber zuerst abgelehnt. Erst nach Rekursen sprach die Kasse die Kosten gut, dazwischen lagen Monate, in denen eine Krankheit unter Umständen unerkannt hätte bleiben können. Ein weiteres Beispiel: Bis vor kurzem zahlte die IV für die Behandlung von Geburtsgebrechen bei stark behinderten Kindern die Miete lebensnotwendiger Geräte (SRF berichtete). Eltern müssen diese Kosten jetzt grösstenteils selber übernehmen, auch hier geht es um tausende von Franken. Tausende von Franken, die Familien in diesen Fällen zum Leben fehlen, ganz zu schweigen von den Ängsten, wenn lebensnotwendige Geräte nicht mehr bezahlt werden können.
Aber nicht nur die Bürokratie ist eine Belastung, sondern auch die Finanzen und die Care-Arbeit. Die meisten Familien stemmen die Betreuung ihrer Kinder mit Krankheiten und Behinderungen nämlich praktisch alleine. Die IV vergibt nur zögerlich Intensivbetreuungszuschläge, und die kleine Hilfslosenentschädigung, die Familien für zum Beispiel zusätzliche Betreuung beantragen können, reicht meist nirgendwohin. Die meisten Familien entscheiden sich deshalb, dass die Mutter grösstenteils beim Kind bleibt, dieses pflegt und betreut und auch die bürokratische Arbeit übernimmt. Ein unbezahlter Vollzeitjob ohne Sicherheiten, Versicherungen und Altersvorsorge.
Der Staat spart durch diese Frauen Milliarden von Franken Betreuungs- und Beistandskosten. Würde ich zum Beispiel die Arbeit, die ich alleine für die Bürokratie der genetischen Abklärungen investierte, im Stundenansatz meiner Selbstständigkeit abrechnen, käme ich auf einen Betrag von mindestens 5000 Franken. Besonders absurd dabei: Geben Eltern ihre Kinder mit Behinderungen in ein Heim, wo Pflegepersonal sowie ein Beistand übernehmen, berappt das die öffentliche Hand mit mehr als 10’000 Franken pro Monat.
«Die Pflege kranker oder behinderter Kinder zu Hause stellt für Eltern und Erziehungsberechtigte eine anspruchsvolle Aufgabe dar. Sie stehen dabei vor grossen persönlichen, finanziellen und organisatorischen Herausforderungen sowie schwierigen Entscheidungen im Alltag.» Das hält der Bundesrat im Rahmen des IV-Gesetzes fest. Doch Anerkennung alleine hilft nicht: 54’000 Kinder mit Behinderungen leben in der Schweiz und mit ihnen ihre Familien. Viele der Mütter – vor allem diejenigen, die weniger privilegiert sind als ich – werden durch die Überlastungen irgendwann selbst krank, müssen eine IV-Rente und im Alter Ergänzungsleistungen wegen drohender Altersarmut beziehen. Nachhaltige Lösungen sehen anders aus: Zum Schluss müssen nämlich die gleichen Sozialsysteme und Krankenkassen einspringen, die vorher an den Frauen sparten.
Bemühungen, die Situation der Familien zu verbessern, sind zwar seit Jahren im Gange, doch die Mühlen mahlen langsam. Beim sogenannten Erwerbsmodell der Angehörigenpflege dürfen zum Beispiel neu private wie auch öffentliche Spitex-Betriebe pflegende Angehörige anstellen. Bezahlt wird allerdings nur für Grundpflegeleistungen, wie zum Beispiel Haare waschen, eincremen oder Orthesen anlegen. Der Intensivpflegezuschlag wurde je nach Schweregrad der Behinderung oder der Erkrankung um 470 bis 940 Franken pro Monat erhöht, auch das ist eigentlich grundsätzlich positiv. Doch Familien mit Kindern mit Entwicklungsstörungen, Autismus oder ADHS, bei denen vor allem die fordernde Betreuung und Therapien und die Entlastung der Eltern das Thema sind, fallen oft durch die Maschen.
Ob meine Tochter eine Belastung ist? Ich hoffe, die Gesellschaft verinnerlicht endlich, dass Menschen, die gepflegt und betreut werden müssen, nicht schuld an der Ermüdung ihrer Angehörigen sind. Schuld sind die Systeme, in denen wir leben und die anstatt auf den Menschen auf Profit ausgerichtet sind.
Übrigens: Bald sind Wahlen. Es kandidieren nun viele Menschen mit Behinderungen, welche die Anliegen von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen in die Politik tragen. Die Pro Infirmis hat dazu eine Behindertenliste erstellt. Ich wünsche mir mehr Menschen in der Politik, die verstehen, was uns beschäftigt. Und gegen Bemühungen vorgehen, Krankenkassen oder IV-Leistungen zu kürzen und nur noch denen zur Verfügung zu stellen, die es sich leisten können.