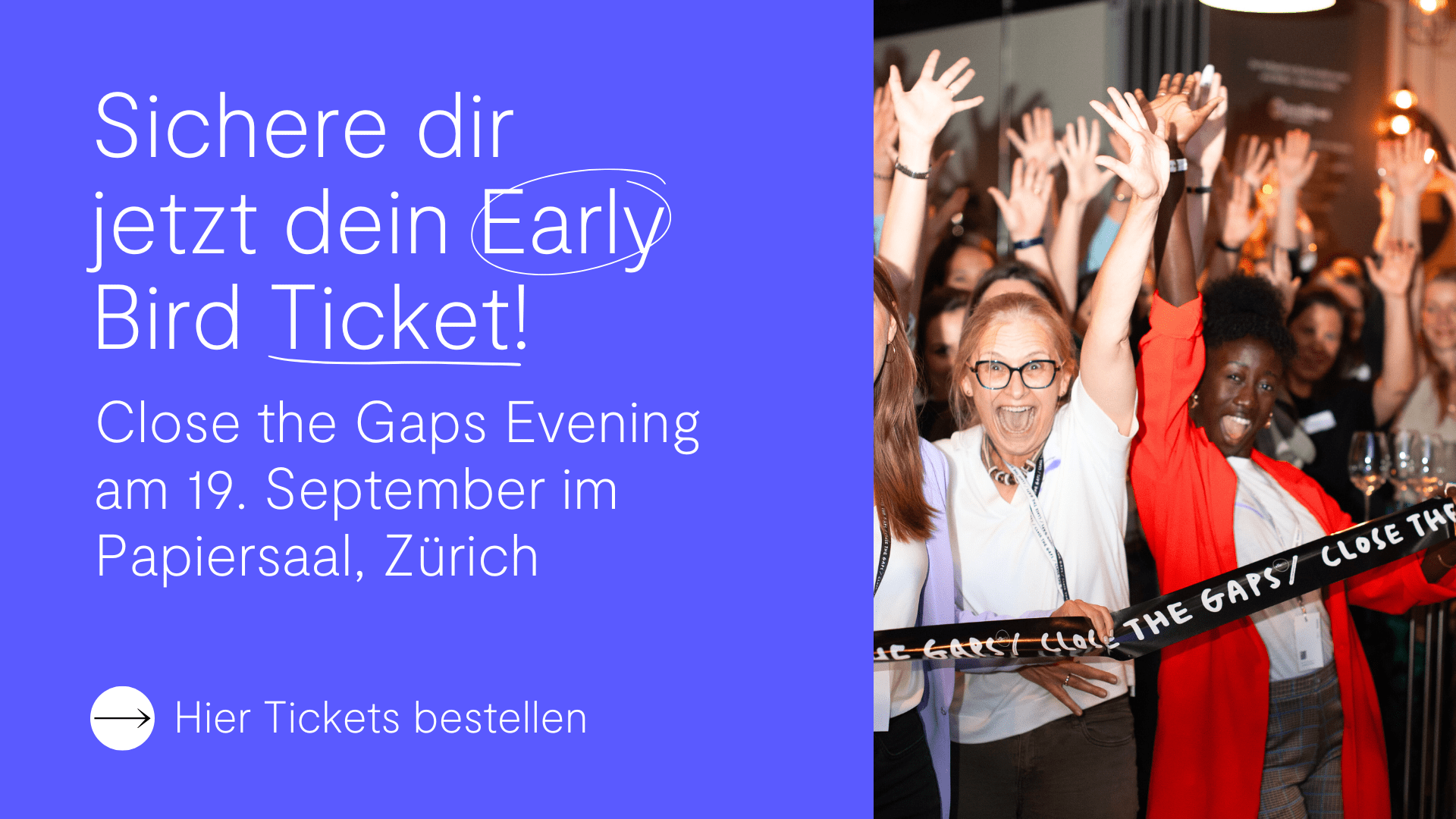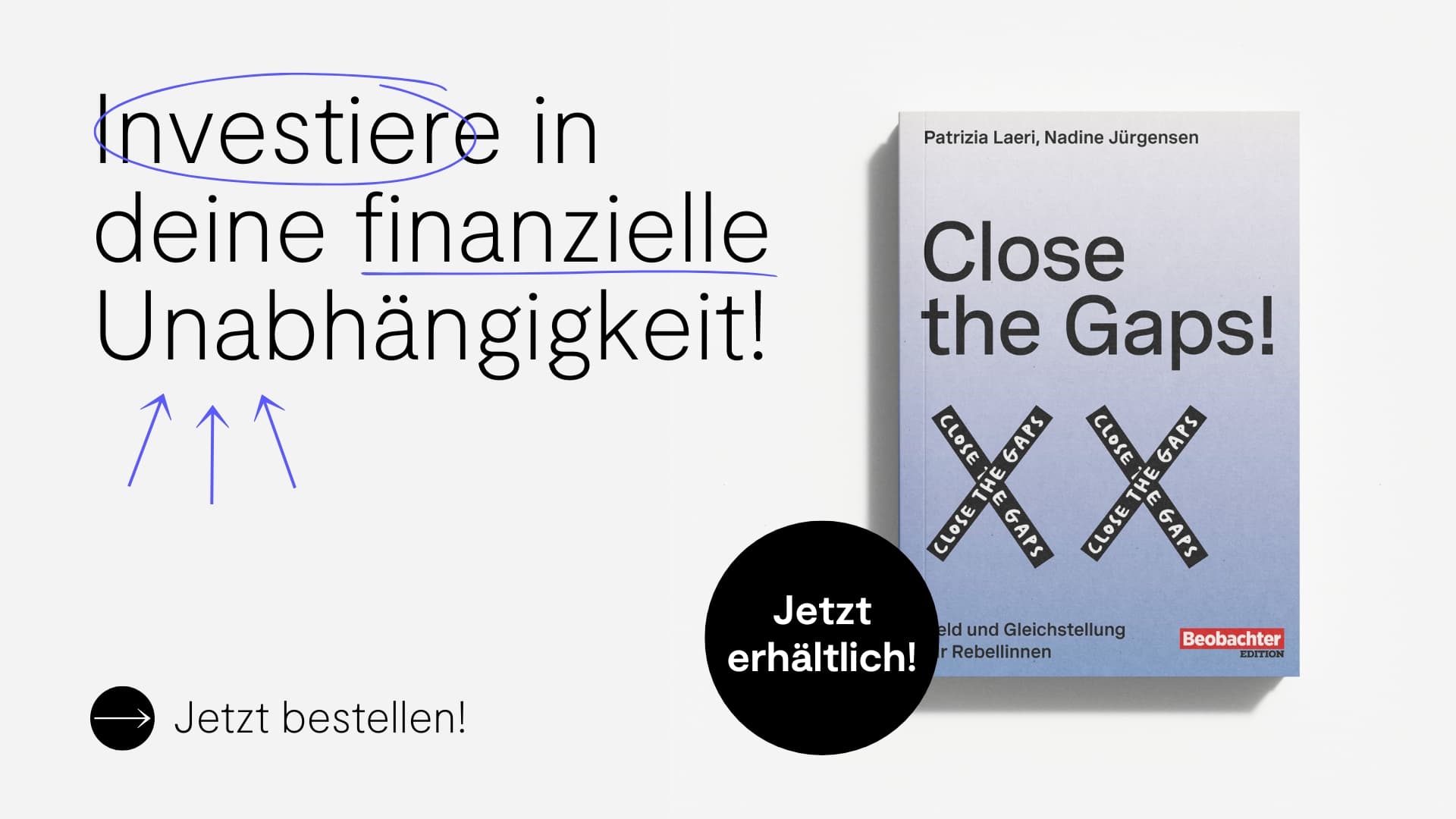Diese Erzählung beginnt mit einer Freundin, deren Typus sicher vielen Frauen bekannt ist. Während ich es schon wieder nicht geschafft habe, mehr als Nudeln mit Pesto zum Znacht zu kochen, bringt sie zwei kleine Kinder und eine beeindruckende Karriere in der Privatwirtschaft unter einen Hut, ist intelligent, zielstrebig und tough, gleichzeitig auch noch sympathisch und hilfsbereit – Typ Superwoman.
Was sie ebenfalls getan hat: Sie hat ein Jahr nach ihrem Doktorat (natürlich mit Bestnote) der universitären Ökonomie den Rücken gekehrt. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass ihr beruflicher Weg bei Ökonominnen in der Schweiz keine Seltenheit ist.
Das Resultat: An allen Volkswirtschafts-Departementen (VWL) der Schweizer Universitäten ist der Anteil Frauen an den Professuren verschwindend gering. So steht die Universität Basel mit 4 Frauen von 20 VWL-Professuren im Vergleich sogar noch sehr gut da – die erst 2016 gegründete Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Luzern hat 4 von 4 VWL-Professuren mit Männern besetzt.
Wie kommt es dazu? Dass Männer in Führungspositionen allgemein übervertreten sind, ist bekannt, hierzu gibt es eine Vielzahl an Studien. Es scheint jedoch, dass der Mangel an Frauen in der universitären Ökonomie in der Schweiz besonders eklatant ist. In Zeiten von Wirtschaftskrisen, gesellschaftlicher Polarisierung und Klimakatastrophe sind gute volkswirtschaftliche Lösungen wichtiger denn je – und damit vielseitige Stimmen aus allen Teilen der Bevölkerung.
Zunächst eine kurze Einordnung der obigen Zahlen: In Schweizer Unternehmen betrug der Anteil Frauen in Positionen mit Vorgesetztenfunktion im Jahr 2023 immerhin 38.5 Prozent. Der Frauenanteil an Professuren an Universitäten in der Schweiz liegt über alle Disziplinen hinweg im Vergleich bei 28.4 Prozent – sehr tief, aber deutlich über dem Frauenanteil bei den VWL-Professuren.
Da stellt sich die Frage: Interessieren sich die Schweizerinnen nicht für ein Ökonomie-Studium, oder schaffen sie es nicht bis zur VWL-Professur? Das sagen die Zahlen: Der Frauenanteil bei den Studierenden in den Wirtschaftswissenschaften lag 2023/24 bei 35.3 Prozent. Tiefer liegt die Quote nur bei den technischen Wissenschaften – bei den Geistes- und Sozialwissenschaften liegt der Frauenanteil hingegen bei 69.2 Prozent. Da die Ökonomie offiziell ebenfalls zu den Geistes- und Sozialwissenschaften gehört, verwundern diese Zahlen zumindest mich.
Auch in Deutschland liegt der Frauenanteil in der VWL nicht nur unter dem universitären Durchschnitt aller Fächer, sondern auch unter dem der Mathematik. Der grosse Bruch, die berüchtigte «Leaky Pipeline», findet sich jedoch bei der Beförderung zur ordentlichen Professur und somit bei den unkündbaren und sehr gut bezahlten Stellen. In Deutschland ist der Anteil Frauen in der VWL mit 33 bis 40 Prozent von den Studierenden bis zu den Junior-Positionen (Promovierende, Postdocs und Assistenzprofessuren) relativ stabil – und fällt dann auf 15.4 Prozent bei den ordentlichen Professuren. In der Schweiz sieht es wahrscheinlich ähnlich aus.
Ein Blick auf die absolute Spitze der Forschung zeigt darüber hinaus: der Wirtschaftsnobelpreis ging bisher 90-mal an einen Mann und dreimal an eine Frau. Mit dieser Gender-Verteilung wird die VWL nur von der Physik überboten, die einen Männeranteil von 97.8 Prozent bei den Nobelpreisträger:innen aufweist. Der Genderdoppelpunkt wird hier fast überflüssig.
Ohne die Gender-Klischee-Keule schwingen zu wollen, fällt auf, dass die drei Nobelpreise an Ökonominnen für deren Arbeiten «im Bereich Gemeinschaftsgüter» (Elinor Ostrom), «zur Bekämpfung der weltweiten Armut» (Esther Duflo) und zu «Arbeitsmarktergebnisse(n) von Frauen» (Claudia Goldin) verliehen wurden. Ist es Zufall, dass hier soziale und gesellschaftliche Themen so stark im Fokus stehen? Hierzu passt zumindest die Beobachtung, dass in Deutschland der Frauenanteil in der Entwicklungs- und Arbeitsmarktökonomie dreimal so hoch ist wie in der Makroökonomie.
Für die Schweiz lässt sich aufgrund der geringen Anzahl Beobachtungen keine solche Statistik erstellen. Eine aktuelle Studie weist darauf hin, dass in den Bereichen Gesundheits-, Bildungs-, Arbeitsmarkts- und Entwicklungsökonomie Publikationen häufiger von Frauen geschrieben werden als in anderen Forschungsbereichen. Aufgrund ihrer durch die eigene Biografie geprägten Lebenserfahrungen und Interessen liegt die Vermutung nahe, dass Frauen andere Themen in ihre wissenschaftlichen Arbeiten einbringen könnten.
Im öffentlichen und politischen Diskurs finden sich heutzutage viele prominente weibliche Stimmen zu Wirtschaftsthemen, die mutige neue, teilweise unkonventionelle Denkansätze einbringen. International hören wir Isabella Weber, deutsche Ökonomin an einer US-amerikanischen Universität, die die Inflation in Europa neu erklärt. Oder die italienisch-britische Ökonomin Mariana Mazzucato, die in linken Kreisen bekannt ist für ihre neue Sicht auf Wirtschaftspolitik. Aus der deutschsprachigen Klimabewegung sind die Politökonomin Maja Göpel und die Umweltökonomin Claudia Kempfer nicht wegzudenken. In Bern und anderswo in der Schweiz erschaffen Frauen neues feministisches Wissen zu (Care-)Ökonomie. Dies sind nur einige Beispiele von vielen, die zeigen, wie von Frauen oft neue Perspektiven gedacht und vielseitiges ökonomisches Wissen in den öffentlichen Diskurs eingebracht wird.
Wissenschaftliche Machtpositionen sind für Ökonominnen jedoch noch immer schwer zu erreichen. Die Gründe dafür sind nicht abschliessend geklärt, aber sicher vielfältig. Übernehmen Ökonominnen mehr Care-Arbeit, investieren sie weniger Zeit in den Beruf als andere Frauen? Oder gibt es in der VWL mehr Diskriminierung im Laufe des Karrierewegs oder ein toxischeres Arbeitsumfeld als anderswo?
Diese Aspekte mögen eine Rolle spielen. Einen weiteren finden wir in den Arbeiten einer Ökonomin: Die Nobelpreisträgerin Claudia Goldin hat Karrierewege von Frauen untersucht, insbesondere in Jobs, in denen ständige zeitliche Verfügbarkeit gefordert und diese zeitliche Präsenz durch einen hohen Lohn und Aufstiegschancen überproportional belohnt wird. In Unternehmen kennen wir das vor allem aus Leitungspositionen. In der Wissenschaft wird ständige Verfügbarkeit bereits bei Junior-Positionen gefordert – und später unter Umständen mit einer Professur belohnt. Als Harvard-Professorin weiss Goldin, wovon sie spricht.
Versuchen junge Forschende in dieser Arbeitsumgebung, ein gleichberechtigtes Eltern-Modell zu leben, riskieren sie, dass am Ende beide ohne Professur dastehen. Nicht nur in der Ökonomie, generell besteht in den Wissenschaften ein überraschend klassisches Arbeitsmodell – entweder du bist jederzeit verfügbar, oder du bist raus.
Dabei gibt es inzwischen viele in Unternehmen erprobte neue Arbeits- und Organisationsmodelle, die in der Wissenschaft genauso gut funktionieren würden, wenn eine Universität sich trauen würde, sie umzusetzen. Job- und Top-Sharing, Vertretungen und flache Hierarchien mit geteilter Verantwortung werden inzwischen in vielen Bereichen erfolgreich gelebt. An den universitären Hochschulen unterrichten zwar viele Ökonom:innen Arbeitsmarkt- und Organisationstheorie, aber sie selbst leben diese Modelle kaum.
In diesem Sinne sind die Universitäten in der Tat ein Elfenbeinturm. Nicht nur Frauen würden von einer überfälligen Anpassung der veralteten Arbeitsstrukturen an unsere moderne Lebensweise profitieren.
Und meine Superwoman-Freundin wäre vielleicht heute nicht in der Privatwirtschaft, sondern Professorin an einer Universität, wo sie mithelfen würde, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit zu lösen.
Universität Basel: 4 von 20 VWL-Professuren.
Universität Bern: 3 von 18, inklusive Assistenzprofessuren – alle drei Frauen sind Assistenzprofessorinnen.
ETH Zürich: Die ETH hat kein Ökonomie-Departement wie die anderen Universitäten, drei weibliche Ökonomie-Professorinnen an den Departementen für Management und Sozialwissenschaften; KOF ETH Zürich: keine Professorinnen.
Universität Fribourg: 1 von 10 Professuren.
Université de Genève: 2 von 12 Professuren (assoziierte und ordentliche Professuren), plus 1 männlicher Assistenzprofessor am Institute of Economics and Econometrics.
Universität Lausanne: 3 von 20 inklusive Assistenzprofessuren; 2 von 14 ordentliche Professuren-
Universität Luzern: 0 von 4 VWL-Professuren.
Université de Neuchâtel: 0 von 4 VWL-Professuren an der Faculté des sciences économiques.
Universität St. Gallen: 1 von 13 ordentliche Professuren, 1 von 3 assoziierte Professuren, 4 von 8 Assistenzprofessuren.
Università della Svizzera Italiana: 2 von 9 ordentliche VWL-Professuren – u.U. ungenau, da einige Personen nicht eindeutig der VWL, BWL oder Data Science zugeordnet werden können (eigene qualitative Einschätzungen auf Basis der Website-Angaben).
Universität Zürich: 5 von 36 Professuren, inklusive Assistenzprofessuren; 1 von 27 ordentlichen Professuren. (jfr)
Zur Person: Jana Freundt ist Ökonomin und Verhaltenswissenschaftlerin an der Hochschule Luzern, wo sie im Bereich Sozialpolitik forscht und unterrichtet.

Ja, das unterstütze ich!
Weil Gleichstellung auch eine Geldfrage ist.
Wie wär’s mit einer bezahlten Membership?
MembershipOder vielleicht lieber erst mal den Gratis-Newsletter abonnieren?
Gratis NewsletterHilf mit! Sprich auch Du über Geld. Weil wir wirtschaftlich nicht mehr abhängig sein wollen. Weil wir gleich viel verdienen möchten. Weil wir uns für eine gerechtere Zukunft engagieren. Melde Dich bei hello@ellexx.com
Schicke uns deine Frage: